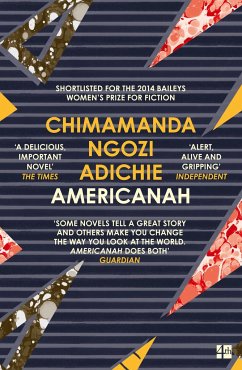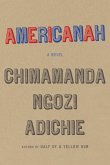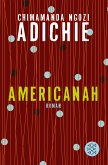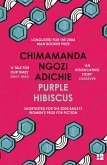Die große Liebe von Ifemelu und Obinze beginnt im Nigeria der neunziger Jahre. Dann trennen sich ihre Wege: Während die selbstbewusste Ifemelu in Princeton studiert, strandet Obinze als illegaler Einwanderer in London. Nach Jahren kehrt Ifemelu als bekannte Bloggerin von Heimweh getrieben in die brodelnde Metropole Lagos zurück, wo Obinze mittlerweile mit seiner Frau und Tochter lebt. Sie treffen sich wieder und stehen plötzlich vor einer Entscheidung, die ihr Leben auf den Kopf stellt.
Adichie schreibt bewundernswert einfach, grenzenlos empathisch und mit einem scharfen Blick auf die Gesellschaft. Ihr gelingt ein eindringlicher Roman, der Menschlichkeit und Identität eine neue Bedeutung gibt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Adichie schreibt bewundernswert einfach, grenzenlos empathisch und mit einem scharfen Blick auf die Gesellschaft. Ihr gelingt ein eindringlicher Roman, der Menschlichkeit und Identität eine neue Bedeutung gibt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

In den Vereinigten Staaten sind die Bücher von Immigranten längst in den Bestsellerlisten angekommen. Sie erzählen nicht nur die Geschichten der Einwanderer, sondern drehen sich um die Frage unserer Zeit: Wo kommst du her?
Es hat seine ganz eigene Poesie, wenn man die Namen aufzählt, die heute eher früher als später fallen, sobald man über die interessantesten Autoren der englischsprachigen Literatur spricht: Jhumpa Lahiri, Chang-rae Lee, Junot Díaz, Edwidge Danticat, Mohsin Hamid, Chimamanda Ngozi Adichie, Susan Choi, Dinaw Mengestu, Tan Twan Eng, Jeet Thayil, NoViolet Bulawayo. Auf jeder Shortlist amerikanischer (oder auch britischer) Literaturpreise stehen seit ein paar Jahren Namen wie diese, Namen von Autoren, die keine native speaker des Englischen sind, Autoren, deren Muttersprache Amharisch heißt oder Malayalam oder Igbo. Viele von ihnen haben die Sprache ihrer Kindheit längst verlernt, ihre Pässe weisen sie als Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika aus, und auch wenn es ihnen manchmal seltsam vorkäme, Amerika ihre Heimat zu nennen, scheinen sie sich immerhin in ihrer Zweitsprache zu Hause zu fühlen.
"Immigrantenliteratur" ist der Begriff, auf den sich ihre Bücher bringen lassen, nicht nur, weil diese Autoren in einem anderen Land geboren wurden, sondern schon auch, weil es Geschichten der Einwanderung sind, die sie erzählen, Geschichten vom Weggehen und Nie-ganz-Ankommen. Es ist ein hilfloses und unverschämtes Wort, weil in der Anerkennung, die es ausdrücken will, immer auch eine Geringschätzung mitschwingt: Wer es bemerkenswert findet, wie gut all diese Autoren die englische Sprache beherrschen, der meint eben auch leicht: für einen Immigranten.
Dabei liegt die Kraft ihrer Geschichten nicht darin, dass sie irgendwie repräsentativ wären für eine universelle Migrantenerfahrung oder dass sich ihre Stimmen gar zu einer Bewegung zusammenfassen ließen, die antritt, um etwa gegen die Stadtspaziergangsprosa weißer Akademikersöhne aus Brooklyn zu protestieren. Wenn es überhaupt einen Grund gibt, ihre Bücher wie die Bände eines großen Einwanderer-Epos zu lesen, dann, weil es eben nicht die eine Geschichte gibt, die die indische Professorentochter mit dem Sohn politischer Flüchtlinge aus Äthiopien oder dem eines dominikanischen Fabrikarbeiters verbindet.
Der Blick der Neuankömmlinge auf das Land ist schon deshalb immer ein besonderer, weil er zunächst nur einen Ausschnitt zeigt, und dass es sich dabei um ein Zerrbild handelt, verstärkt eher die literarische Wahrhaftigkeit. Es ist die enge Perspektive der Diaspora und manchmal nicht einmal die. Für Yunior, das Alter Ego von Junot Díaz' aus dessen autobiographisch gefärbten Kurzgeschichten, ist es der Blick auf die im Schnee spielenden Nachbarskinder durch die beschlagenen Fenster.
In "Invierno", einer der Storys aus dem neuen Band "Und so verlierst du sie", schildert Díaz, wie Yunior die ersten Monate nach seiner Ankunft aus der Dominikanischen Republik erlebte. Nach fünf Jahren hatte der Vater die Familie nach New Jersey geholt, Yunior, seinen Bruder Rafa und deren Mutter, aber die Freude über das eigene Zimmer und die funktionierende Toilettenspülung im neu gebauten Apartment hält nicht sehr lange. Draußen ist Winter, aber der Vater ein Tyrann, der den Kindern verbietet, das Haus zu verlassen. "Es ist zu kalt, sagte Papi einmal, aber in Wahrheit war der einzige Grund, dass er es so wollte." Statt Schneemänner und Iglus gibt es Zimmerarrest und stundenlanges Fernsehen, Englischunterricht von der "Sesamstraße". "Es war unser erster Tag in den Staaten. Die Welt war zu Eis erstarrt."
Ähnlich geht es Yasmin, der Frau, die im Mittelpunkt der Geschichte "Otravida, Otravez" steht, der einzigen aus weiblicher Perspektive. Was sie von Amerika sieht, sind die Laken, die sie in der Wäscherei eines Krankenhauses reinigt, von den Menschen, die hier zu Hause sind, kennt sie nur die Blutflecken, so viel Blut, man "könnte glauben, in der Welt wüte ein großer Krieg". Nach fünf Jahren in Amerika fühlt sie sich wie eine Veteranin. "Aber damals, ganz am Anfang", sagt sie, "war ich so einsam, dass sich jeder Tag anfühlte, als würde ich mein eigenes Herz essen."
Das graue Musterleben der weißen Amerikaner ist für Díaz' Figuren so unerreichbar, dass sie sich lieber in einen Nationalstolz flüchten, der ihnen wenigstens erlaubt, das Gefängnis der Diaspora als Selbstbehauptung auszugeben. Bei Yunior, der schon 1996 in Díaz' erstem Kurzgeschichtenband "Abtauchen" auftrat, schlägt sich das vor allem in seinen Beziehungen nieder. Sosehr er sich wünscht, auch in der Liebe endlich irgendwo anzukommen, so sehr sträubt er sich gegen die Arriviertheit einer dauerhaften Partnerschaft. Wenn er seine Freundinnen beschreibt, läuft es immer auf eine Liste körperlicher Attribute hinaus, auf Brüste und Ärsche und eine komplexe sexuelle Hierarchie der Hautfarben.
Aber Yuniors Chauvinismus hilft ihm nicht nur, seine Unsicherheit zu verstecken, er lässt sich auch hervorragend als Bekenntnis zu seinem kulturellen Erbe ausgeben, als Traditionspflege dominikanischer Macho-Kultur. Man muss nicht groß psychologisieren, um in Yuniors Promiskuität das Abbild einer postnationalen Ambiguität zu sehen: Díaz' Figuren sind sich nie sicher, ob es richtig ist, zu gehen oder zu bleiben, wann es Zeit ist, zu verlassen, das Land oder die Frau des Lebens - oder zurückzukehren. Ob sie ihre Frauen betrügen sollen oder, wenn sie es nicht tun, sich selbst. Mit seinen Frauen geht es Yunior wie mit der verklärten Heimat: Er liebt sie erst, wenn er sie verlassen hat.
Es ist also kein Zufall, dass es sich bei vielen Geschichten immigrierter Autoren um Liebesgeschichten handelt, um Geschichten, die von emotionalen Fragen handeln, welche in ihren Biographien eine große Rolle spielen: Zurückweisung und Akzeptanz, Distanz und Nähe, sich kennenlernen und sich fremd werden, das sind für die Helden dieser Geschichten sehr existentielle Erfahrungen.
Auch die nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie verpackt diese Themen in ihrem Roman "Americanah" in die Geschichte einer Jugendliebe, von ihrem Verlust durch die Emigration und die Frage, ob es möglich ist, zu ihr zurückzukehren. Ifemelu und Obinze, zwei Kinder der gehobenen, englischsprachigen nigerianischen Mittelschicht, verlieben sich als Teenager, doch als Ifemelu zum Studieren in die Vereinigten Staaten geht, trennen sich ihre Wege. Wie Adichie, so gehört auch ihre selbstbewusste Heldin zu einer neuen Art von Migranten, "gut genährt und bewässert, aber steckengeblieben in Unzufriedenheit", flieht sie nicht vor dem Hunger, sondern "vor der unterdrückenden Lethargie der Perspektivlosigkeit".
Ifemelu geht auch in Amerika erfolgreich ihren Weg, bekommt, wie Adichie, ein Stipendium in Princeton, und dass sie die Sehnsucht nach ihrer Heimat doch nie ablegen kann, das liegt auch daran, dass sie eine andere geworden ist, seit sie Lagos verlassen hat: eine Schwarze. In Nigeria hatte sie das nie gespürt.
Adichie, die es mit einem Ausschnitt aus einem feministischen Vortrag dank Beyoncés Song "Flawless" bis in die Popcharts geschafft hat, erörtert in ihrem Roman sehr präzise, was es heißt, schwarz zu sein. Mit der zynischen Souveränität einer vom Rassismus bisher weitgehend verschonten Afrikanerin zerlegt Ifemelu in ihrem Blog "Raceteenth" die Absurditäten eines hochdifferenzierten rassistischen Systems, das mit der Unterscheidung zwischen African-Americans und American-Africans endgültig ins Schleudern kommt.
Gleichzeitig aber kann Ifemelu gar nicht verhindern, zur "Americanah" zu werden, wie ihre Freundinnen in Lagos jene Rückkehrer nennen, die sich von den nigerianischen Zuständen entfremdet haben. Obinze erkennt seine Freundin, als er ihren Blog liest, genauso wenig wieder wie Ifemelu, als sie zurückkehrt, ihr Land: "War es immer so", fragt sie sich, als sie das Chaos in Lagos überfällt, "oder hat sich in ihrer Abwesenheit so viel verändert?" Oder sie sich? Sie sähe jetzt, beklagt sich eine Freundin, die Dinge mit den Augen einer Amerikanerin. "Aber das Problem ist, dass du nicht einmal eine richtige Americanah bist. Wenn du wenigstens einen amerikanischen Akzent hättest, würden wir deine Beschwerden tolerieren."
Wohin man geht, immer bleibt etwas zurück: Deutlicher kann man das nicht veranschaulichen als Dinaw Mengestu in seinem vor ein paar Tagen erschienenen Roman "All Our Names". Es ist das dritte Buch des gebürtigen Äthiopiers, auch er erzählt die Geschichte eines Paares, das sich trennen muss, die Geschichte von zwei Freunden, die die politischen Wirren nach der Unabhängigkeit Ugandas auseinanderbringt. Damit der eine fliehen kann, muss er zum andern werden, zu seinem Freund Isaac, der ihm sein Visum schenkt, seinen Pass, seinen Namen. In Amerika, in der Abgeschiedenheit des Mittleren Westens, beginnt für den neuen Isaac ein neues Leben, das erst gar keines ist: "Ich lebe, als ob ich nicht wirklich hier bin", ist die Maxime, an die sich Isaac hält. Erst als er sich in die Sozialarbeiterin Helen verliebt (die es in ihrem engen Leben nicht einmal bis nach Chicago geschafft hat), lässt er sich auf Amerika ein. In Mengestus Roman "Die Melodie der Luft" von 2010 gibt es eine Formel, mit der die Mutter des Helden die Verwandlung in eine Amerikanerin beschwört: "Sag oft genug Amerika."
Die Frage, ob einer dazugehören will, zu der einen oder anderen Gemeinschaft, ist nicht nur eine von Nationalität oder Ethnie. Und dass das Recht, seinen eigenen Weg zu finden, nicht von der Antwort auf diese Frage abhängt, ist eine Wahrheit, die nur das Vokabular der Literatur beschreiben kann, nicht die engen Begriffe der Integrationsdebatten. "Meine Mutter wollte nicht, dass ich Amerikanerin werde, denn die Amerikaner waren ja die anderen, die Fremden", hat Jhumpa Lahiri einmal gesagt, die Bestsellerautorin mit bengalischen Wurzeln, geboren in London, aufgewachsen in Rhode Island. Seit dem Erfolg ihrer Kurzgeschichten "Interpreter of Maladies" 1999 gilt sie als Chronistin der Lebensgeschichten indischer Einwanderer, oft Akademiker, und deren mitgebrachter Ehefrauen, die eher leise an der Fremdheit ihrer aufgeräumten Vorstadtsiedlungen leiden.
Oder auch nicht: Ihre Figuren wirken oft verhältnismäßig versöhnt mit den Veränderungen und seufzen allenfalls manchmal etwas melancholisch, während sie lernen, wie man Truthahn brät, Ostereier versteckt und Schneemänner baut. Aber gerade im Verzicht auf den Diaspora-Refrain vom ständig an seiner Identität zweifelnden Globalisierungsopfer liegt auch eine emanzipatorische Kraft. Lahiris Charaktere sind eben immer zuerst Mütter, Väter oder Töchter, sind Teenager oder Professoren, bevor sie Immigranten sind. Den Begriff "Immigrantenliteratur" hat Lahiri daher immer zurückgewiesen: "Wenn wir bestimmte Bücher Immigrantenliteratur nennen", schrieb sie einmal, "wie nennen wir dann den Rest? Einheimischenliteratur? Puritanische Literatur?"
In "The Lowland", Lahiris neuem Roman, spielen die Motive der Migration nur noch eine Nebenrolle. Es geht um zwei ungleiche Brüder, die im Kalkutta der 1950er Jahre aufwachsen. Udayan, der Ältere, schließt sich einer maoistischen Bewegung an, Subhash, der Jüngere, studiert Ozeanographie in Rhode Island, und als Udayan seinem Engagement zum Opfer fällt, heiratet Subhash dessen Frau Gauri und kümmert sich fürsorglich um seine Nichte. Und dass nicht immer klar ist, wie manche Kritiker bemängelten, ob Lahiri ein politisches Epos erzählen will oder eine Familientragödie, das liegt womöglich daran, dass auch ihre Figuren nicht immer so genau wissen, ob es sich bei ihrer Lebensgeschichte um das eine oder das andere handelt. Am Ende landet Gauri als Philosophiedozentin an einer Uni in Kalifornien, eine erneute Flucht, diesmal vor ihrem persönlichen Schicksal. "Sie traf andere Flüchtlinge von der Ostküste, die aus ihren eigenen Gründen geflohen waren . . . Genug von diesen Leuten, dass es keine Rolle mehr spielte, woher sie ursprünglich stammte."
Amerika ist, wie jeder Name einer Nation, immer auch eine Illusion, das Versprechen einer Gemeinschaft, welches auch für jene, die schon immer dort leben, längst nicht mehr gilt. Zerrissenheit, Isolation, flüchtige Identitäten: Das sind in einer Welt in Bewegung nicht mehr nur die Symptome einer kleinen Gruppe von Migranten. Wer wissen will, wer einer ist, fragt ihn immer auch: Wo kommst du her? Und manchmal, wenn die Antwort darauf etwas komplexer ist, tragischer oder abenteuerlicher, ist es der Stoff für gute Literatur.
Junot Díaz, für den Amerika auch immer die Fiktion war, die er aus dem Fernsehen kannte, aus Comics oder Büchern, hat die Frage nach seiner Identität trotzdem einmal in einer kurzen Formel erklärt: Er sei, in einem Wort, Shazam! Es ist das Zauberwort, das den Jungen Billy Batson mit einem Blitz in den Superhelden Captain Marvel verwandelt. Er selbst sei weder Billy Batson noch Captain Marvel, sondern der Blitz: "Das Ding, das die beiden zusammenhält und ihre Verwandlung möglich macht."
HARALD STAUN
Junot Díaz: "Und so verlierst du sie", übersetzt von Eva Kemper, S. Fischer, 272 Seiten, 16,99 Euro. Chimamanda Ngozi Adichie: "Americanah", Anchor, 497 Seiten, 24,99 Euro (erscheint Ende April bei S. Fischer). Dinaw Mengestu: "All Our Names", Alfred A. Knopf, 256 Seiten, um 20 Euro. Jhumpa Lahiri: "The Lowland", Bloomsbury, 352 Seiten, um 10 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
'A brilliant novel: epic in scope, personal in resonance and with lots to say' Elizabeth Day, Observer
'A delicious, important novel from a writer with a great deal to say' The Times
'A brilliant exploration of being African in America ... an urgent and important book, further evidence that its author is a real talent' Sunday Telegraph
'An extremely thoughtful, subtly provocative exploration of structural inequality, of different kinds of oppression, of gender roles, of the idea of home. Subtle, but not afraid to pull its punches' Alex Clark, Guardian
'A tour de force ... The artistry with which Adichie keeps her story moving, while animating the complex anxieties in which the characters live and work, is hugely impressive' Mail on Sunday
'Adichie is terrific on human interactions ... Adichie's writing always has an elegant shimmer to it ... Wise, entertaining and unendingly perceptive' Independent on Sunday
'Adichie paints on a grand canvas, boldly and confidently ... This is a very funny, very warm and moving intergenerational epic that confirms Adiche's virtuosity, boundless empathy and searing social acuity' Dave Eggers
'"An honest novel about race" ... with guts and lustre ... within the context of a well-crafted, compassionate, visceral and delicately funny tale of lasting high-school love and the sorrows and adventures of immigration' Diana Evans, The Times
'[A] long, satisfying novel of cross-continental relationships, exile and the pull of home ... Adichie's first novel for seven years and well worth the wait' FT
'Alert, alive and gripping' Independent
'A delicious, important novel from a writer with a great deal to say' The Times
'A brilliant exploration of being African in America ... an urgent and important book, further evidence that its author is a real talent' Sunday Telegraph
'An extremely thoughtful, subtly provocative exploration of structural inequality, of different kinds of oppression, of gender roles, of the idea of home. Subtle, but not afraid to pull its punches' Alex Clark, Guardian
'A tour de force ... The artistry with which Adichie keeps her story moving, while animating the complex anxieties in which the characters live and work, is hugely impressive' Mail on Sunday
'Adichie is terrific on human interactions ... Adichie's writing always has an elegant shimmer to it ... Wise, entertaining and unendingly perceptive' Independent on Sunday
'Adichie paints on a grand canvas, boldly and confidently ... This is a very funny, very warm and moving intergenerational epic that confirms Adiche's virtuosity, boundless empathy and searing social acuity' Dave Eggers
'"An honest novel about race" ... with guts and lustre ... within the context of a well-crafted, compassionate, visceral and delicately funny tale of lasting high-school love and the sorrows and adventures of immigration' Diana Evans, The Times
'[A] long, satisfying novel of cross-continental relationships, exile and the pull of home ... Adichie's first novel for seven years and well worth the wait' FT
'Alert, alive and gripping' Independent