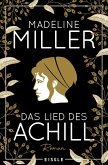Auf einer Forschungsreise wird Nastassja Martin von einem Bären gebissen und schwer verletzt. In aufwühlenden Worten erzählt sie von der Geschichte dieses Kampfes und von ihrer Genesung.
Die Anthropologin Nastassja Martin teilt in dieser packenden autobiografischen Erzählung die Geschichte einer tiefen Verletzung und ihrer Heilung. Auf einer ihrer oft monatelangen Forschungsreisen auf die von Vulkanstümpfen durchzogene russische Halbinsel Kamtschatka, wo sie die Bräuche und Kosmologien der Ewenen studiert, taucht sie tief in deren Kultur ein und beginnt intensiv zu träumen. Nach einer Bergtour begegnet sie einem Bären: Es kommt zum Kampf, er beißt sie ins Gesicht und die 29-Jährige gerät in einen Zustand versehrter Identität. Was sie zuvor als Wissenschaftlerin beschrieben hat - die animistische Durchmischung von allem - erfährt sie nun am eigenen Leib. Die Grenzen zwischen dem Bären und ihrer selbst, oder dem, was früher sie selbst war, verschwimmen. Träume und Erinnerungen lassen Nastassja Martin umfassende Heilung in sich selbst und der Wildnis finden, in die sie nach einer qualvollen Genesungsgeschichte in russischen und französischen Krankenhäusern zurückkehrt.
Die Anthropologin Nastassja Martin teilt in dieser packenden autobiografischen Erzählung die Geschichte einer tiefen Verletzung und ihrer Heilung. Auf einer ihrer oft monatelangen Forschungsreisen auf die von Vulkanstümpfen durchzogene russische Halbinsel Kamtschatka, wo sie die Bräuche und Kosmologien der Ewenen studiert, taucht sie tief in deren Kultur ein und beginnt intensiv zu träumen. Nach einer Bergtour begegnet sie einem Bären: Es kommt zum Kampf, er beißt sie ins Gesicht und die 29-Jährige gerät in einen Zustand versehrter Identität. Was sie zuvor als Wissenschaftlerin beschrieben hat - die animistische Durchmischung von allem - erfährt sie nun am eigenen Leib. Die Grenzen zwischen dem Bären und ihrer selbst, oder dem, was früher sie selbst war, verschwimmen. Träume und Erinnerungen lassen Nastassja Martin umfassende Heilung in sich selbst und der Wildnis finden, in die sie nach einer qualvollen Genesungsgeschichte in russischen und französischen Krankenhäusern zurückkehrt.

Zum 50. Mal: "Schöne Aussichten"
FRANKFURT Kamtschatka? Terra incognita. Niemand auf dem Podium im Frankfurter Literaturhaus wusste mit der nordostsibirischen Halbinsel etwas anzufangen. Dabei ist unter dem Titel "An das Wilde glauben" (Matthes & Seitz) erst vor Kurzem ein Buch der Ethnografin Nastassja Martin über Kamtschatka erschienen und in der F.A.Z. gleich zweimal besprochen worden. Jetzt aber war es ein Roman, den die professionelle Tennisdame und Autorin Andrea Petkovic als Gast der Kritikerrunde "Schöne Aussichten" vorstellte, des "Flaggschiffs" des Literaturhauses, wie Programmchef Hauke Hückstädt zur 50. Ausgabe glücklich hervorhob. Nicht ganz zufällig also hat Petkovics New Yorker Nachbarin Julia Phillips ihren Kriminalroman "Das Verschwinden der Erde" (dtv) genannt. Kamtschatka ist schon verschwunden, jedenfalls aus dem Bewusstsein des Westens.
Zwei Mädchen, elf und acht Jahre alt, sind nicht mehr aufzufinden. Der Roman löst den Fall. "Ein Kaleidoskop der Persönlichkeiten an einem unbekannten Flecken der Welt", so Petkovic. Wie ein Trauerflor ziehe sich das Verschwinden der Landschaft durch den Text. Mara Delius, Literaturkritikerin der Tageszeitung Die Welt und zum letzten Mal mit dabei, lobte die "verdichtete Atmosphäre" und tadelte die "erklärenden Sätze". Hubert Spiegel, Redakteur im Feuilleton der F.A.Z., hat das Buch gern gelesen, vermisste aber mehr Auskünfte über die Indigenen und die russischen Kolonisten. Da witterte Moderator Alf Mentzer vom Hessischen Rundfunk "kulturelle Aneignung" im Roman. "Nein", rief Delius. Als gebürtige Serbin wies Petkovic noch eigens auf "die Verhältnisse zwischen Mann und Frau in einer postsowjetischen Gesellschaft" hin.
Unter dem Titel "Levys Testament" (Suhrkamp) habe Ulrike Edschmid "drei Romane in einem auf 140 Seiten" verfasst, so Spiegel. Delius stellte das Buch vor mit der Frage, die den Text durchziehe: "Wie kann ein Jude ein Zuhause finden?" Die Mutter des Protagonisten mit seiner geheimen Familien- und öffentlichen Aufstiegsgeschichte in der Opernkunst habe ja auch vorausgesagt: "Du wirst dich nie zu Hause fühlen." Petkovic hätte sich "mehr klassische Erzähltechnik" gewünscht und nannte die Autorin "eine Meisterin des Weglassens". Als die Sportlerin auf ihren Lieblingsverein Tottenham Hotspur zu sprechen kam und Mentzer die Verbindung zu einer Shakespeare-Figur in "Henry IV." zog, hatte Spiegel "einen neuen Lieblingsverein" gefunden. Dennoch wandte er ein, man müsse viel über Zeitgeschichte wissen, um der Autorin folgen zu können.
Dann stellte er Judith Hermanns neuen Roman vor, der unter dem Titel "Daheim" bei S. Fischer erschienen ist: "Auch diese plastischen Figuren haben kein Zuhause." Spiegel wusste vor allem "den Wechsel aus Präzision und Unschärfe" zu schätzen: "Spannend geschrieben und entschlackt. Das tut gut." Delius konstatierte "wenig Affekte", Mentzer sprach von einer Aversion der Autorin gegen psychologische Erklärungen. Petkovic, die Romane mit Psychologie liebt, fand das Buch "zäh", aber als "impressionistisches Gemälde" wusste sie es zu schätzen. Von "trostlosen Verhältnissen" sprach Spiegel, von einer Frau, die nur im Hafenbecken schwimme, weil sie Angst habe vor dem offenen Meer. Ein "atmosphärisches Mobile" zwischen Freiheit und Begrenzung nannte Mentzer den Roman, aber: "Gelungen." "Absolut", kam das Echo von Spiegel.
Auch J. D. Salinger mit seinem pubertierend-fluchenden "Fänger im Roggen" (Kiwi) fand allgemeines Wohlgefallen und bestand damit den "Haltbarkeitstest". Petkovic war "total verliebt" in den Außenseiter Holden Caulfield und hätte ihn am liebsten zu einem brauchbaren Menschen erzogen. Er sei ja auch im Grunde "ein gutherziger Bursche", bestätigte Spiegel und zitierte aus Hesses Rezension von 1954: Das Buch führe "vom Ekel zur Liebe". Mehr könne Dichtung nicht erreichen.
CLAUDIA SCHÜLKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Rezensent Urs Hafner geht Nastassja Martins Essay "An das Wilde glauben" nicht mehr aus dem Sinn. Zunächst widmet er der Kulturanthropologin ein knappes Porträt, in dem er vor allem auf ihr radikales Wissenschaftsverständnis eingeht, um anschließend voll Bewunderung jenes Ereignis zu schildern, das Martin zum Anlass für ihr Buch wurde: Eine im Traum bereits vorhergeahnte Begegnung mit einem Bären, die für sie beinahe tödlich ausgegangen wäre. In ihrem Buch geht sie der Frage nach, was diese extreme Erfahrung zu bedeuten hat, denn dass sich ein Sinn darin verbirgt, steht für Martin außer Frage. Um diesen zu finden, denkt sie über ihren eigenen Weg in die Ethnologie, ihre Erfahrungen mit der Medizin, vor allem aber über die Lebensart der Ewenen nach, einer kleinen Gemeinschaft von Menschen in den Wäldern Sibiriens, deren Erforschung sie überhaupt erst in jene gefährliche Situation brachte, lesen wir. Dabei entwickeln ihre reflektierten Beschreibung eine ganz eigene Poesie, die jedoch niemals überhand nimmt, schließt der Rezensent, bei dem dieses, wie er findet, schöne, spannende und intelligente Buch noch lange lange nachhallt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH