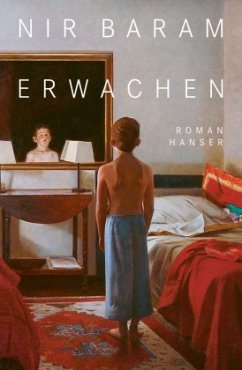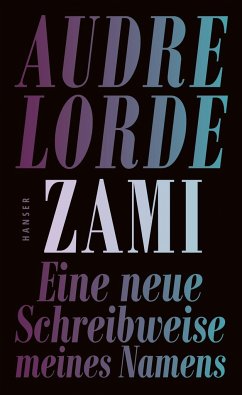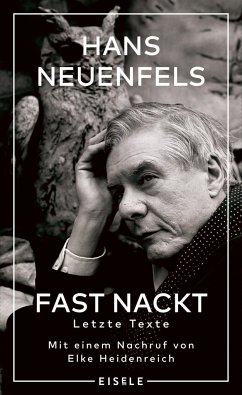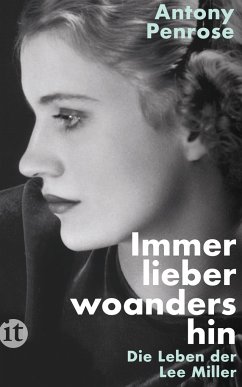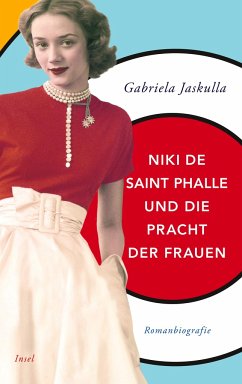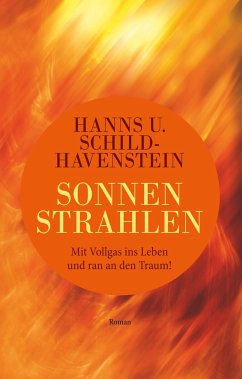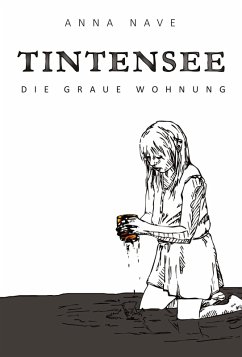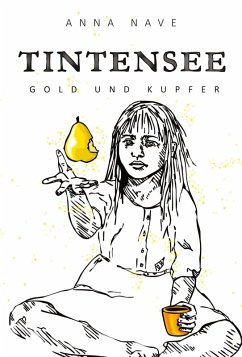An einem Freitag im April
Eine Geschichte von Suizid und Überleben
Übersetzung: Stingl, Nikolaus

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Als an einem Freitagabend im April 2006 die Sonne am Himmel untergeht, findet sich Donald Antrim auf dem Dach seines Wohnhauses in Brooklyn wieder - bereit, hinunterzuspringen. Er hängt sich ans Geländer der Feuertreppe, lässt prüfend mit einer Hand los. Was ihn dazu bewegt hat, gerade an diesem Tag aufs Dach zu klettern, weiß er nicht, doch es war kein impulsiver Akt: Suizid gehört als Gedanke schon lange zu seinem Leben. Denn Selbstmord ist für ihn eine Krankheit, ein andauernder Schmerz in Folge von Trauma und Isolation.Präzise und schonungslos ehrlich schildert Antrim, was ihn auf ...
Als an einem Freitagabend im April 2006 die Sonne am Himmel untergeht, findet sich Donald Antrim auf dem Dach seines Wohnhauses in Brooklyn wieder - bereit, hinunterzuspringen. Er hängt sich ans Geländer der Feuertreppe, lässt prüfend mit einer Hand los. Was ihn dazu bewegt hat, gerade an diesem Tag aufs Dach zu klettern, weiß er nicht, doch es war kein impulsiver Akt: Suizid gehört als Gedanke schon lange zu seinem Leben. Denn Selbstmord ist für ihn eine Krankheit, ein andauernder Schmerz in Folge von Trauma und Isolation.
Präzise und schonungslos ehrlich schildert Antrim, was ihn auf das Dach führte und was danach geschah. Er befreit die Krankheit so von dem Geheimnis und dem Stigma, das sie von jeher umgibt. Ein zutiefst wahrhaftiges Buch, nicht nur über Suizid, sondern über uns alle, unsere Kultur, unsere Existenz - und darüber, wie wir ein besseres, authentischeres Leben führen können.
Präzise und schonungslos ehrlich schildert Antrim, was ihn auf das Dach führte und was danach geschah. Er befreit die Krankheit so von dem Geheimnis und dem Stigma, das sie von jeher umgibt. Ein zutiefst wahrhaftiges Buch, nicht nur über Suizid, sondern über uns alle, unsere Kultur, unsere Existenz - und darüber, wie wir ein besseres, authentischeres Leben führen können.