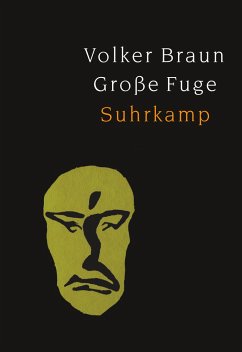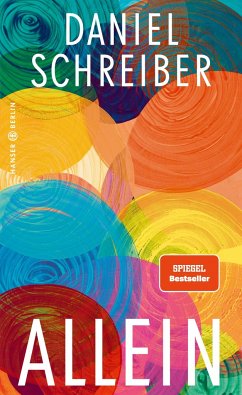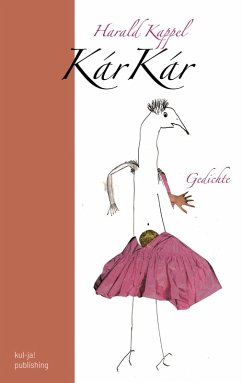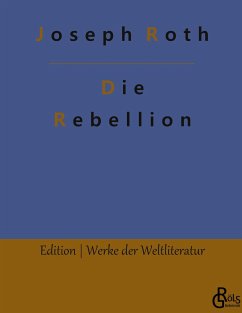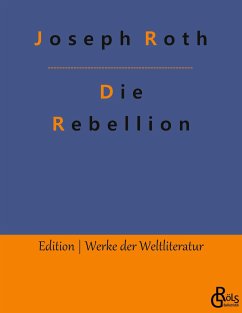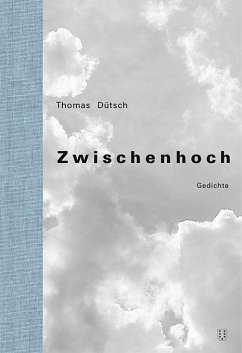An einem Morgen im März
Langgedicht
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
22,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Björn Kuhligk erweist sich erneut als politischer Lyriker und verfasst ein Langgedicht über das Jahr 2020 in dem die Normalität unseres Alltags zusammenbrach.Zwei Jahre nach dem ersten Lockdown wagt Björn Kuhligk das Unaussprechliche und präsentiert den genervten Pandemieprofis in uns ein Langgedicht über die Erfahrung, die alle mehr verändert hat, als wir ahnen. Die Leere / vor mir und mich selbst im Rückspiegel / mit der Leere hinter mir, so beginnt die Reise durch den Zyklus jenes Jahrs, in dem sich die Chance der Ruhe in Starre verwandelte, in dem die Grenzen nur noch für die Spar...
Björn Kuhligk erweist sich erneut als politischer Lyriker und verfasst ein Langgedicht über das Jahr 2020 in dem die Normalität unseres Alltags zusammenbrach.Zwei Jahre nach dem ersten Lockdown wagt Björn Kuhligk das Unaussprechliche und präsentiert den genervten Pandemieprofis in uns ein Langgedicht über die Erfahrung, die alle mehr verändert hat, als wir ahnen. Die Leere / vor mir und mich selbst im Rückspiegel / mit der Leere hinter mir, so beginnt die Reise durch den Zyklus jenes Jahrs, in dem sich die Chance der Ruhe in Starre verwandelte, in dem die Grenzen nur noch für die Spargelstecher aus Rumänien geöffnet wurden und Selfies irgendwann Räudigkeit, Hilflosigkeit und Bedürftigkeit ausstrahlten. Mit sozialkritischem Blick und dem Gespür eines Fotografen bannt Kuhligk Empfindungen und Beobachtungen in Momentaufnahmen mit Langzeitwirkung.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.