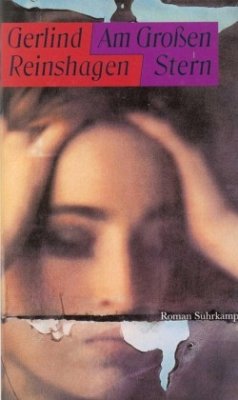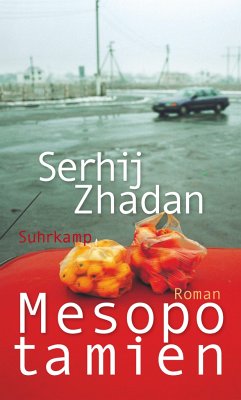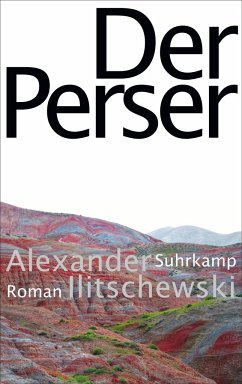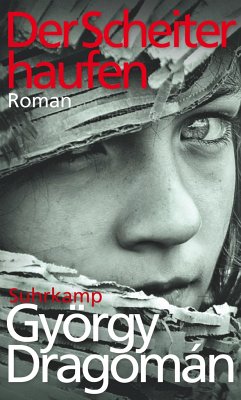Nicht lieferbar

Anatolin
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Kein Verzeichnis körperlicher und seelischer Gebrechen kennt diese Krankheit, kein Arzt hat sie je diagnostiziert, und doch leidet manch einer darunter: "Morbus biographicus", zu deutsch: "autobiographische Entleerung". Das Symptom: fehlende Erinnerung an die eigene Kindheit. Am Ende steht der Verlust jedes biographischen Gefühls. Als Therapie bleibt nur, den fehlenden autobiographischen Faden erzählend neu zu spinnen.So wird für den Helden dieses heiter-melancholischen Buches eine Kindheit in der ostwestfälischen Provinz lebendig, in der der verlorene Bruder dominiert. Die Suche nach der...
Kein Verzeichnis körperlicher und seelischer Gebrechen kennt diese Krankheit, kein Arzt hat sie je diagnostiziert, und doch leidet manch einer darunter: "Morbus biographicus", zu deutsch: "autobiographische Entleerung". Das Symptom: fehlende Erinnerung an die eigene Kindheit. Am Ende steht der Verlust jedes biographischen Gefühls. Als Therapie bleibt nur, den fehlenden autobiographischen Faden erzählend neu zu spinnen.
So wird für den Helden dieses heiter-melancholischen Buches eine Kindheit in der ostwestfälischen Provinz lebendig, in der der verlorene Bruder dominiert. Die Suche nach der eigenen Vergangenheit wird zu einer Suche nach den Eltern. Sie führt in den Osten, in ein abgelegenes Straßendorf in der Ukraine, dann in eine noch viel kleinere Siedlung im ehemaligen Wartheland in Polen. Was der Vergangenheitslose dort an Spuren seiner Vorfahren findet, ist nichts - und doch mehr als genug, um einen Roman daraus zu machen.
Wer meint, in dieser Lebensgeschichte die Biographie des international erfolgreichen Autors Hans-Ulrich Treichel wiederzuerkennen, ist auf der richtigen Spur - und wird doch in die Irre geführt. In Anatolin gibt Treichel dem Thema seiner preisgekrönten Romane Der Verlorene und Menschenflug eine überraschende Wende. So entsteht ein raffiniertes, ebenso unterhaltsames wie witzig-kluges Vexierspiel mit den Voraussetzungen autobiographischen Erzählens, ein Tanz mit dem fremden Selbst auf der Suche nach der eigenen Biographie.
So wird für den Helden dieses heiter-melancholischen Buches eine Kindheit in der ostwestfälischen Provinz lebendig, in der der verlorene Bruder dominiert. Die Suche nach der eigenen Vergangenheit wird zu einer Suche nach den Eltern. Sie führt in den Osten, in ein abgelegenes Straßendorf in der Ukraine, dann in eine noch viel kleinere Siedlung im ehemaligen Wartheland in Polen. Was der Vergangenheitslose dort an Spuren seiner Vorfahren findet, ist nichts - und doch mehr als genug, um einen Roman daraus zu machen.
Wer meint, in dieser Lebensgeschichte die Biographie des international erfolgreichen Autors Hans-Ulrich Treichel wiederzuerkennen, ist auf der richtigen Spur - und wird doch in die Irre geführt. In Anatolin gibt Treichel dem Thema seiner preisgekrönten Romane Der Verlorene und Menschenflug eine überraschende Wende. So entsteht ein raffiniertes, ebenso unterhaltsames wie witzig-kluges Vexierspiel mit den Voraussetzungen autobiographischen Erzählens, ein Tanz mit dem fremden Selbst auf der Suche nach der eigenen Biographie.





heikesteinweg_sv.jpg)