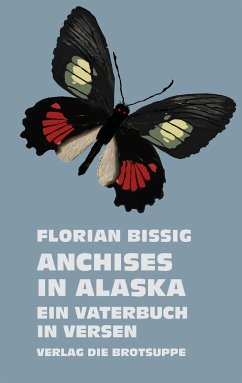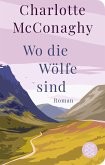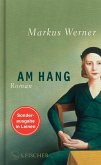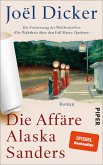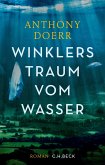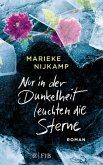Was, wenn der Tod des anderen die Möglichkeit des Nachfragens ausgelöscht hat? Das lyrische Ich, das in diesem Buch die ganze Redezeit beansprucht, will sich nicht mit einem Monolog zufriedengeben. Es hält daran fest, den Abwesenden im Gespräch zur Anwesenheit zu verführen. Zu diesem Behuf geht es dorthin, wo die Grenzen von Anwesenheit und Abwesenheit, von Sein und Nichtsein, von Leben und Tod nebulös werden: ins Reich der Einbildungskraft. Durch das Einrücken in eine geteilte Welt von literarischen Imaginationen findet es einen Resonanzraum, in dem sich sein jambischer Redefluss in ein mehrstimmiges Tableau auffächert. So trifft sich der Sprecher kraft der Erinnerung und kraft der Fantasie mit seinem Vater irgendwo im Grenzbereich zwischen Ober- und Unterwelt, zwischen Biografie und Fiktion, zwischen Erinnerung und Tagtraum. Einmal begegnet er ihm als waghalsigem Teufelskerl zu Fuss in Alaska, ein andermal trägt er ihn als gelähmten Anchises aus dem brennenden Troja. Und immer befragt er ihn, bohrend, aber liebevoll, zu seinen Lebensentwürfen und Fantasien.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Zeuge einer behutsamen Suche nach dem verstorbenen Vater, wird Rezensent Tilman Spreckelsen im Lyrikband von Florian Bissig. Im Zentrum steht die "ungeheure Schweigsamkeit" des Vaters, den das lyrische Ich am Ende seines Lebens begleitet. Seine Krankheit erschwert ihm das Sprechen zusätzlich, doch der Vater ist auch ein schwer greifbarer, zurückgezogener Mensch, der sich seiner Umwelt verweigert und sein Schicksal passiv erwartet: "Die Uhren immer auf- / gezogen, dass die Zeit nicht stehen bleibt, / hast nur erduldet und gewartet, und uns / betrachtet, wie wir dich zerfallen sahen." In ungereimten Blankversen versucht der Sohn eine lyrische Annäherung an diesen ihm fremd gebliebenen Mann, so Spreckelsen, dabei führe ihn die Suche auch in die Mythologie, zum Beispiel zu Anchises, dem Vater des Trojaners Aeneas. Das autobiografisch geprägte, lyrische Ich ist hier einerseits "erinnerndes Kind", andererseits Erwachsener, der auch auf seine eigene Vaterschaft reflektiert, so der Kritiker. Bissig hat hier aus einer sehr persönlichen Geschichte ein "eigenständiges Kunstwerk" geschaffen, in dem auch viele Leser Anknüpfungspunkte finden können, lobt der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH