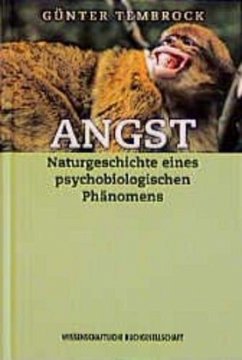Da bleibt der Fisch kühl - kein Gefühl! Günter Tembrock beobachtet tierische Rückzugsstrategien und hält Angst für die natürlichste Sache der Welt
Wenn ein Hund den Schwanz einzieht und sich winselnd in einen Winkel verkriecht, dann wird er wohl Angst haben. Doch was wissen wir tatsächlich über die Empfindungen von Tieren? Mitunter gelingt es uns Menschen ja nicht einmal, die Gefühle unserer Mitmenschen richtig einzuschätzen. Wer schlicht und einfach von sich auf andere schließt, liegt mit seiner Deutung manchmal ziemlich daneben. Das gilt erst recht für Begegnungen mit Vierbeinern, selbst wenn uns deren Mimik durchaus vertraut erscheint. Was zum Beispiel bei einem Schimpansen oder Berberaffen wie ein strahlendes Lächeln aussieht, ist wahrscheinlich eher ein Zeichen von Angst als von Freude. Denn unsere haarigen Verwandten zeigen diesen Gesichtsausdruck stets dann, wenn ihnen ein stärkerer Artgenosse bedrohlich nahekommt.
Wer das Gefühlsleben von Tieren studiert, bewegt sich auf schwierigem Terrain. Kein Wunder, daß viele Wissenschaftler diese Ebene lieber ausklammern. Nicht so Günter Tembrock - schon als frischgebackener Professor an der Humboldt-Universität Berlin hat er sich mit einschlägigen Fragen beschäftigt. Wenn er nun, fast vierzig Jahre später, eine "Naturgeschichte der Angst" entwirft, beleuchtet er diesen emotionalen Zustand aus unterschiedlichen Blickwinkeln, stellt ihn in den Kontext von Raum und Zeit, individuellen Erfahrungen und sozialen Beziehungen. Neben Biologen und Medizinern kommen dabei auch Psychologen und Philosophen zu Wort.
Das klingt vielversprechend. Und zweifellos hat der Autor viel Interessantes und Wissenswertes zusammengetragen. Um seine Leser umfassend zu informieren, holt er entsprechend weit aus. Die "Grundanlage des Wirbeltier-Gehirns" wird ebenso erörtert wie Grundlagen der Verhaltensforschung. Doch ein sprödes Gelehrtendeutsch, gespickt mit einer Vielzahl von Fachbegriffen, macht die Lektüre bisweilen eher mühselig. Verhalten, so erfährt man zum Beispiel, "ist organismische Interaktion mit der Umwelt auf der Grundlage eines Informationswechsels zur Sicherung der Entwicklung". Zwei Seiten sind anschließend vonnöten, um dieses Statement fachgerecht zu erläutern.
Was unter dem Begriff Angst zu verstehen ist, wird ebenfalls eingehend ausgelotet. Dabei unterscheidet der Autor zwischen brenzligen Situationen, aus denen ein Tier mit einem artspezifischen Verhaltensmuster entkommen kann, und solchen, für die es kein genetisches Programm gibt. Die einen lösen nach seiner Definition "Furcht" aus, die anderen "Angst". Wer seine ererbten Verhaltensprogramme geschickt mit Erlerntem kombiniert, ist demnach weitgehend furchtlos, dafür aber um so ängstlicher. Vielleicht hat sich diese Terminologie aus gutem Grund nicht so recht durchsetzen können.
Auch wenn der Autor nicht mit Begriffen aus der Umgangssprache hantiert, zeigt er eine ausgeprägte Vorliebe für ausgefeilte Klassifizierungen und hierarchisch strukturierte Diagramme. Ob sich des Lebens ganze Fülle immer zwanglos in solche Schubladen einordnen läßt, mag dahingestellt bleiben. Letztlich gipfelt das Gedankengebäude in der Hypothese, "daß der Zustand der Angst dazu dient, durch neuronale Umorganisation alle ,Reserven' erworbenen Wissens und Könnens freizulegen, um vielleicht doch noch eine Chance für die Existenzsicherung zu erschließen". Zugleich wird postuliert, "daß ,Angst' als emotionales Erleben erst auf der tradigenetischen Stufe entstehen konnte, weil wir das individuell organisierte ,fakultative Lernen' als eine der Voraussetzungen benannt haben". (Der Begriff "tradigenetisch" steht für tradiertes Wissen und Können, das nicht durch bewußte Aneignung erworben wird.) "Bei den neurobiologischen Voraussetzungen gehen wir davon aus, daß es eine Kontrolle der Gehirntemperatur geben muß. Damit wäre das Angstsyndrom nur bei endothermen Tieren zu erwarten, also den Vögeln und den Säugetieren."
Wie beruhigend für passionierte Sportangler, daß ein Fisch, der am Angelhaken zappelt, dabei keinerlei Angst verspürt. Oder ist diese Schlußfolgerung vielleicht doch voreilig? Schließlich bewahren nicht alle Fische einen kühlen Kopf. Thunfisch und Schwertfisch verstehen sich sehr wohl darauf, ihr Gehirn warmzuhalten, ebenso einige Knorpelfische, darunter auch der berüchtigte Weiße Hai: Ihr Blutkreislauf ist derart ausgelegt, daß ihnen die Abwärme der Muskeln zu Kopf steigt. Dank dieser effizienten Heizung können sie auch bei mäßiger Wassertemperatur unvermindert aktiv bleiben und es mit flinken Beutetieren aufnehmen.
Darüber hinaus zeigten kanadische Wissenschaftler vor einigen Jahren, daß zumindest manche Fische fähig sind, lebenswichtige Informationen an ihresgleichen weiterzugeben. Um eine Gefahr zu erkennen und zu meiden, müssen Dickkopf-Elritzen keineswegs selbst schlechte Erfahrungen machen. Damit haben sie auf Tembrocks entwicklungsgeschichtlicher Leiter offenbar die "tradigenetische Stufe" erklommen. Wenn sie erstmals in ihrem Leben den Geruch eines Hechts wahrnehmen, lassen sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Es sei denn, sie teilen ihr Quartier mit kundigen Artgenossen: Dann folgen sie dem Beispiel ihrer flüchtenden Gefährten und steuern schnurstracks einen sicheren Unterschlupf an. Dabei prägen sie sich ein, wovor sie künftig auf der Hut sein müssen.
Die gelehrigen Elritzen teilen ihr Wissen aber nicht nur mit Artgenossen. Wenn sie die Flucht ergreifen, warnen sie damit oft auch benachbarte Stichlinge. Und die Stichlinge können die frischgelernte Lektion dann wiederum an unerfahrene Elritzen weitergeben. Auf diese Weise dürften sich Gefahrenquellen ziemlich rasch herumsprechen. Ob die so unterwiesenen Fische immer ganz cool bleiben? Oder bekommen sie es doch mit der Angst zu tun, wenn ihnen ein bestimmter Duft in die Nase steigt? Das ist wohl weiterhin eine offene Frage - und nicht zuletzt auch eine Frage der Definition.
DIEMUT KLÄRNER
Günter Tembrock: "Angst". Naturgeschichte eines psychologischen Phänomens. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2000, 215 S., Abb., geb., 64,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Schwieriges Terrain, das der Autor da betritt, findet Diemut Klärner. Wenn jeder Mensch schon für seinesgleichen einen Abgrund bedeutet, scheint sie sich zu fragen, wie nah können wir dem Gefühlsleben von Tieren dann kommen? Indessen lässt Klärner auch keinen Zweifel daran, dass sich der Autor wirklich Mühe gegeben hat, uns auf die Sprünge zu helfen. Auf dass wir künftig besser verstehen, was in dem Fisch vorgeht, der an der Angel zappelt. Fürchtet der sich, hat er Angst, oder ist es ihm schnuppe? Tembrock untersuche den emotionalen Zustand der Angst im Kontext von Raum und Zeit sowie unter individual- und sozialpsychologischen Aspekten und lasse sogar Philosophen zu Wort kommen. Das "spröde Gelehrtendeutsch" jedoch und die vielen Fachtermini, schreibt Klärner, machen das Verständnis nicht eben leichter. Und so weit kann der Autor ja offenbar ohnehin gar nicht ausholen, uns in die Grundlagen der Verhaltensforschung einführen - dass uns endlich einleuchtet, warum der Hund den Schwanz einzieht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH