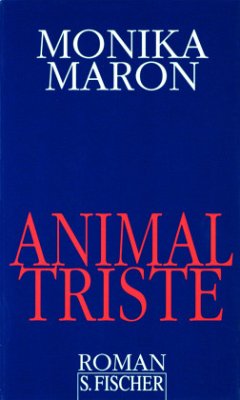Die Erzählerin in diesem Roman erinnert sich zum letzten Mal an ihre Liebe, die ihr im Sommer 1990 begegnete, als sie nicht mehr jung war und noch nicht alt. Nachdem ihr Geliebter sie verlassen hat, zieht sie sich aus der Welt zurück und wiederholt seitdem die Zeit mit ihm als eine nicht endende Liebesgeschichte. Das Ende der Diktatur offenbart die Ordnung ihres Lebens als absurd, die gewonnene Freiheit fügt sich nicht mehr dem Ganzen, sondern stellt die früheren Lebensentscheidungen infrage. Die Liebe zu Franz, der jenseits der Mauer aufgewachsen ist, wird zur obsessiven Leidenschaft, die keinen Verzicht zuläßt und keine Rücksicht. Die Heldin des Romans beschwört die Liebe als letzte anarchische Sinngebung, die sich über jede Ordnung hinwegsetzt und ihre eigene errichtet.

Monika Maron wirft sich ein Tierfell um · Von Gustav Seibt
Der Liebhaber, um den sich die Erinnerungen der Ich-Erzählerin in Monika Marons neuem Roman "Animal triste" drehen, hat "hechtgraue" Augen. Das Hechtgrau der Augen von Franz - so der Name des verlorenen Angebeteten - schimmert aber nicht nur einmal und durch Ausgefallenheit gleichwohl unvergeßlich in dem Roman, sondern es schwimmt alle Augenblicke an die Glaswand dieser Prosa, um dort seinen aparten Fischleib vorzuführen. Immer wieder wird dem Leser mitgeteilt, daß die Augen des attraktiven Franz hechtgrau sind. Doch ist es die Eigentümlichkeit solcher erlesenen Adjektive, daß man sie nicht zu oft benutzen darf, ohne Überdruß zu erwecken, so wie man auch einen Witz demselben Publikum nicht zweimal erzählen sollte: Er wirkt nur beim ersten Mal. Und das Adjektiv "hechtgrau" ist durch den Kunsthistoriker Harald Keller schon so berühmt geworden, daß sich die weitere Verwendung fast verbietet.
Verstimmend aber ist das wiederkehrende Hechtgrau nicht nur aus solchen allgemeinen Erwägungen, sondern aus zwei romaninternen Gründen. Erstens prätendiert es einen sprachlichen Reichtum, den der stilistisch ganz unauffällige Text nicht einlöst, gleich einem zu auffälligen Straßschmuck auf einem einfarbigen Kostüm. Und zweitens ist seine Funktion banal, so banal wie die ganze Konstruktion des Romans. In Franz begegnet der Ich-Erzählerin "das Andere", nämlich nicht einfach ein Mensch, sondern Natur überhaupt, deren letzter Rest in uns, wie der Roman mitteilt, die Liebe sei. Der Roman, beziehungsweise die Erzählerin, teilt immer alles mit, damit der Leser nicht selbst drauf kommen muß. Das Hechtgrau drängt sich so vor, um die urtümliche Besonderheit des sonst ganz farblosen Franz wenigstens äußerlich zu beglaubigen.
Es geht also um Liebe, Liebe ganz allgemein als naturhafte, verzehrende, ungesellige und übergeschichtliche Macht. Erzählt wird die letzte Liebe einer alternden Frau um die Fünfzig aus dem Rückblick des ganz hohen Alters um die Neunzig. Allerdings treibt der Roman ein preziöses Spiel mit der Chronologie. Sie ist zwar ziemlich eindeutig, weil die Liebende unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ein Kind war und ihren Franz unmittelbar nach dem Fall der Berliner Mauer kennengelernt hat. Doch wird immer wieder mitgeteilt, der Erzählerin sei unklar, vor wieviel Jahren diese bedingungslose Liebe sich abgespielt habe, die ihr so dauerhaft gegenwärtig vor Augen steht. So weit hat sich die Liebende aus Zeit und Geschichte entfernt.
Es ist deshalb rüde und gemein, wenn man das Datenmaterial gleichwohl kurz zusammenstellt: Franz, ein Ameisenforscher, kommt als westlicher Evaluierer in ein naturgeschichtliches Museum nach Ost-Berlin und lernt dort unter dem Skelett eines Brachiosaurus (aha, Vorgeschichte) seine Geliebte kennen, die in ihm die verpaßte große Jugendliebe erkennt, den einen Menschen, für den sie vor aller Zeit bestimmt war. Einen oder zwei Sommer lang kommt der verheiratete Franz allabendlich ins Bett der Ich-Erzählerin, die naturhaft namenlos bleibt, eine Art Inconnue de la Spree. Ja, und um dieses Bett wachsen, man wagt kaum, es weiterzusagen, fleischfressende Pflanzen! Nun würde mancher Leser vielleicht die Peinlichkeit dieser fleischfressenden Pflanzen am liebsten sofort wieder vergessen, auch wenn sie auf ihre Weise ebenso unverdrängbar ist wie das Hechtgrau der Augen; allein man kann sie nicht übersehen, diese fleischfressenden Pflanzen, weil sie nämlich wie Franzens Augen, ja sogar noch öfter, als Leitmotiv bemüht werden und ihre dumme Bedeutung über das Liebeslager wuchern lassen.
Obwohl der Roman so den Akzent ganz auf die Natur, aufs Vorzivilisatorische und Archaische legt, kann er nicht ganz umhin, sich hin und wieder auf Geschichte und ihre wirklichen Orte einzulassen. Aber auch sie bekommen gewissermaßen ein Tierfell übergeworfen und sollen aus urzeitlicher Ferne gesehen werden. Am Ende verschlägt es die Ich-Erzählerin nach New York, und ganz erwartungsgemäß entdeckt sie da die Großstadt als Dschungel, in der die Kabel und Rohre wie verwesende Eingeweide herumliegen und die Kräne sich wie Saurierskelette über die Dächer beugen. Auch die DDR kommt vor und wird als "Mutation" charakterisiert oder, fast als sei's von Handke, fern verschwimmend als "die seltsame Zeit".
Seltsam ist freilich vor allem, wie sehr Monika Maron ihre wahren Talente verkennen konnte. Respektabel waren ihre früheren Romane, vor allem "Flugasche" und "Stille Zeile sechs", da, wo sie ein wiedererkennbares Milieu aus eigener Erfahrung schilderten. Die Qualitäten von Marons Prosa waren immer eher stofflich, vornehmlich journalistisch, und wahrscheinlich sind ihre vorlauten Essays und Glossen überhaupt das Beste, was sie geschrieben hat. Es gibt auch im Roman "Animal triste" eine beeindruckende Passage, und gerade sie kokettiert nicht mit dem Animalischen. Dort nämlich erinnert die Ich-Figur sich an ihre Kindheit in den Berliner Ruinen und an die Veränderung der Mütter, als die Väter aus Krieg und Gefangenschaft zurückkehrten. Hier zeichnet Monika Maron unprätentiös ein Kapitel erfahrener Geschichte, sie berichtet von vorübergehender weiblicher Freiheit und ihrem Verlust. Auch das ist Naturgeschichte, wenn auch nicht saurierhaft und ideologisch der Geschichte entgegengesetzt, sondern mit ihr verwachsen.
Nach dem Untergang der DDR und ihrer geschichtsphilosophischen Anmaßung das Terrain völlig zu wechseln und in den Dschungel der Naturgeschichte zu fliehen war als Einfall zu naheliegend, als daß er ästhetisch hätte fruchtbar werden können. Der Roman "Animal triste" ist trotz einiger Kühnheiten bei der Schilderung alternden Frauenfleisches durch und durch konventionell. Auch seine beiläufige politische Botschaft - "Ich habe mein Leben lang zu fest an die Natur geglaubt, um ein guter Mensch zu sein" - wird schon morgen als bequemes Geschwätz dastehen. So einfach läßt sich die schwermütige lateinische Weisheit, jedes Tier sei nach dem Beischlaf traurig, nicht für die Gegenwart allegorisieren.
Es endet nicht gut. Am Schluß kann sich die Erzählerin nicht genau erinnern, ob sie ihren Franz, als er sie verließ, nur zum Bus brachte oder ihn unter die Räder stieß, tötete und so das Gesetz des Dschungels erfüllte. Sie wird jedenfalls zum Tier, zu einem felltragenden Wesen, das sich halbblind, uralt und alterslos zwischen die fleischfressenden Pflanzen zurückzieht und aufs Sterben wartet, auf die Stunde, in der alle Vergangenheit noch einmal zurückkommt. Bonne nuit, tristesse: Wenn das kein Kitsch ist!
Monika Maron: "Animal triste". Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1996. 239 S., geb., 36,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
» Ich glaube, dass es sich um einen der schönsten Liebesromane dieser Jahre handelt. Ein hocherotisches Buch von einer außerordentlichen Intensität. « Marcel Reich-Ranicki Der Spiegel