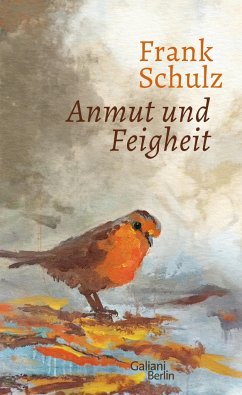Liebe ist nichts für Feiglinge - Frank Schulz blickt in seinen Erzählungen hinauf zu Wolke 7 und hinab in die Abgründe der Seele
Buch des Monats August 2018 bei NDR Kultur
Die Liebe, sie trifft uns alle, und meist ist sie kein Zuckerschlecken, vor allem dann nicht, wenn die Jahre vergehen. Frank Schulz folgt seinen Protagonisten wie ein Privatdetektiv, er nimmt ihre Seelen unter die Lupe - aber er erschrickt nie über das, was er findet. Schulz, der Chronist des ganz alltäglichen Lebens und all seiner Untiefen, fängt den Klang von gesprochener Sprache ein wie niemand sonst.
Ein Juniorsenior (gerade 60) liefert sich per SMS ein Verbal-Pingpong mit seiner jungen Freundin, das so gleichberechtigt fies ist, dass man ganz verzaubert ist: das muss dann doch wohl Liebe sein! Ein Mann und eine Frau schreiben sich Briefe, die der jeweils andere immer erst zwanzig Jahre später öffnen darf. Und überhaupt: Älterwerden ist durchaus keine friedliche Angelegenheit. Wenn die Augen und das Gedächtnis zum Beispiel gerade genug nachgelassen haben, dass man sich, wie die Unternehmerwitwe im Spreewaldresort, nicht mehr sicher ist, ob der Gatte beim Wandern in die Schlucht gestürzt ist - oder ob man selbst ihn ein bisschen geschubst hat.
Frank Schulz, das wird in diesem Erzählband einmal mehr klar, kennt sich aus mit den Schwachheiten der Verliebtheit, den Feigheiten des Egos, mit den brutalen Auswüchsen von Einsamkeit, mit den herzzerreißenden Momenten der Wahrheit.
"Schulz ist ein Meister der Milieubeschreibung." Die Zeit
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Buch des Monats August 2018 bei NDR Kultur
Die Liebe, sie trifft uns alle, und meist ist sie kein Zuckerschlecken, vor allem dann nicht, wenn die Jahre vergehen. Frank Schulz folgt seinen Protagonisten wie ein Privatdetektiv, er nimmt ihre Seelen unter die Lupe - aber er erschrickt nie über das, was er findet. Schulz, der Chronist des ganz alltäglichen Lebens und all seiner Untiefen, fängt den Klang von gesprochener Sprache ein wie niemand sonst.
Ein Juniorsenior (gerade 60) liefert sich per SMS ein Verbal-Pingpong mit seiner jungen Freundin, das so gleichberechtigt fies ist, dass man ganz verzaubert ist: das muss dann doch wohl Liebe sein! Ein Mann und eine Frau schreiben sich Briefe, die der jeweils andere immer erst zwanzig Jahre später öffnen darf. Und überhaupt: Älterwerden ist durchaus keine friedliche Angelegenheit. Wenn die Augen und das Gedächtnis zum Beispiel gerade genug nachgelassen haben, dass man sich, wie die Unternehmerwitwe im Spreewaldresort, nicht mehr sicher ist, ob der Gatte beim Wandern in die Schlucht gestürzt ist - oder ob man selbst ihn ein bisschen geschubst hat.
Frank Schulz, das wird in diesem Erzählband einmal mehr klar, kennt sich aus mit den Schwachheiten der Verliebtheit, den Feigheiten des Egos, mit den brutalen Auswüchsen von Einsamkeit, mit den herzzerreißenden Momenten der Wahrheit.
"Schulz ist ein Meister der Milieubeschreibung." Die Zeit
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Ein zärtliches Buch, eines mit ständig wechselnden Blickwinkeln, eine Schule der Empathie. Joachim Dicks NDRkultur Buch des Monats

Essentielles von Frank Schulz: "Anmut und Feigheit"
Dass man das Leben nur rückwärts verstehen könne, heißt es in dem Kierkegaard-Zitat, das Frank Schulz seinem Erzählband "Anmut und Feigheit" vorangestellt hat. Ob man das Leben überhaupt verstehen kann, aus welcher Perspektive nun auch immer, darüber mag man geteilter Meinung sein. Dass aber angesichts der plötzlich erschreckend konkret werdenden eigenen Endlichkeit und der damit verbundenen Unsicherheit, was die Zukunft betrifft, das Bedürfnis laut wird, sich seiner selbst und immerhin der eigenen Vergangenheit zu versichern, ist allzu gut nachvollziehbar.
Vermutlich ist tatsächlich dieser Impuls Anlass für "Anmut und Feigheit", ein "Prosa-Album über Leidenschaft", wie sich das Buch im Untertitel nennt, und auch dafür, dass die Erzählungen, Schnurren und Anekdoten, die sich mit offenkundig autobiographischen Geschichten abwechseln, chronologisch rückwärts angeordnet sind. Die abschließende Geschichte handelt nicht etwa von der Kindheit des Autors, sondern geht zurück bis in die Lehrjahre des Vaters und endet, während im Hintergrund Helmut Rahn sein folgenschweres Tor schießt, mit folgendem Ausblick: "Und nur ein Jahr und fünf Tage später ereignet es sich, das Wunder von Hagen, das Wunder seines Lebens namens Hildegard." Dieser Satz, das weiß man an dieser Stelle längst, ist nicht eine Spur ironisch gemeint. Denn in dieser Verbindung liegt der Ursprung von Frank Schulz, der dann 1957 geboren wurde.
Und mit dieser guten Nachricht schließt sich der Rahmen von "Anmut und Feigheit", in dessen Auftakttext Frank Schulz, leicht fiktionalisiert, von dem Schlaganfall erzählt, der ihn unlängst ereilt hat, und in dessen zweitem, umfangreichsten Text er vollkommen ungeschützt über seine haltlose Trauer und Verzweiflung angesichts des Todes seiner Mutter berichtet. Was für ein zarter, berührender Moment, wenn Schulz das - vermutlich authentische - Gedicht zitiert, das er zum siebzigsten Geburtstag der Mutter verfasst hat und das voller norddeutsch heruntergespielter, aber natürlich heißer Liebesbekundungen und Neckereien ist.
Wer Frank Schulz als Autor der genialen Hagener Trilogie kennt oder aber als Erfinder von Onno Viets, dem denkbar beklopptesten Privatdetektiv aller Zeiten, der zum Komischsten gehört, was die deutschsprachige Gegenwartsliteratur zu bieten hat, den mag die kaum verhohlene, doch, so muss man es wohl nennen: Sentimentalität, die in " Anmut und Feigheit" mitschwingt, erst einmal verblüffen. Aber natürlich findet man auch reichlich Vertrautes. Zum einen, weil in einigen der Erzählungen Figuren auftauchen, die man aus früheren Romanen des Autors kennt. Leider fehlt dem Band ein Verzeichnis, aus dem hervorgehen würde, ob es sich bei einzelnen Texte um in den Romanen nicht verwendetes Material handelt, das Schulz noch in der Schublade hatte, oder ob sie eigens für diesen Band geschrieben sind. Vielleicht war das aber auch eine bewusste Entscheidung: Es gibt die biographische Klammer, das Dasein dazwischen folgt der Freiheit der Fiktion.
Zum anderen bergen fast alle Texte diese ganz besondere Schulz-Philosophie, die freundliche Zustimmung zum Scheitern, die unaufgeregte Zugewandtheit zu all jenen, die vom Gros ihrer Zeitgenossen für mickrig befunden und nicht oder nur mit Abfälligkeit betrachtet werden. "Die Wirklichkeit - das erweist sich immer wieder - ist stillos." Das klingt bei Schulz weder herablassend noch verbiestert, sondern ist lediglich eine trockene Einsicht, nicht allein in die Umstände, sondern auch in die kaum heroische Haltung, mit der die meisten von uns dem Dasein begegnen.
Und mitunter ist die Wirklichkeit nicht nur stillos, sondern regelrecht erbärmlich. Wie etwa das Leben des fettleibigen, lebensmüden Mannes aus der Erzählung "Geliebte mein im Schuhkarton". Tag für Tag, Jahr für Jahr, hockt er einsam in seiner Wohnung, schleppt sich allenfalls für eine paar Einkäufe hinunter auf die Straße - früher auch noch für den Besuch bei einer Prostituierten - und verbringt sein leeres Leben damit, die Nachbarin zu beobachten, deren Wohnung auf der anderen Hofseite liegt.
Wenn Frank Schulz von diesem Koloss erzählt, dann wird dessen tristes Dasein nicht etwa schillernder, auch Anmut wird man kaum entdecken. Wir werden aber glücklicherweise eben auch nicht zu Voyeuren, die ihre Lust am Ekel allenfalls notdürftig unterdrücken. Stattdessen dürfen wir erleben, was es bedeutet, wenn Empathie so selbstverständlich ist, dass kein großes Gewese darum veranstaltet werden muss.
WIEBKE POROMBKA
Frank Schulz: "Anmut und Feigheit". Ein Prosa-Album über Leidenschaft.
Galiani Verlag, Berlin 2018. 336 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Frank Schulz ist nicht nur witzig! So lautet Rezensent Burkhard Müllers Sendung und es scheint ihm wirklich daran zu liegen sie an jedermann heran zu tragen, der beim Namen Schulz nur an 20,5% oder bestenfalls an Onno Viets, den ulkigen Privatdetektiv denkt. Mit diesem Ansinnen zieht Müller mit dem Galiani Verlag an einem Strang, der jüngst einen Erzählband herausgebracht hat, mit dem man die "Rezeptionsbasis erweitern" und dem vielseitigen Autor endlich die wohlverdiente Anerkennung beschaffen will. Müller, der längst nicht jeden Text der Sammlung rückhaltlos loben kann und diese kritisch "durchwachsen" nennt, freut sich dennoch über "Anmut und Feigheit", denn abgesehen von einigen weniger bedeutsamen Erzählungen und einem quälend unpassenden Griff tief ins Klo, sind dort einige der besten Texte versammelt. Diese zeichnen sich vor allem durch eine markante Sprache und die entblößende Darstellung des Peinlichen aus, hinter der sich jedoch immer ein grundsätzliches Verständnis und Mitgefühl abzeichnet. Sowas ist dann eben nicht nur Satire, sondern große Literatur, meint Rezensent Burkhard Müller.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH