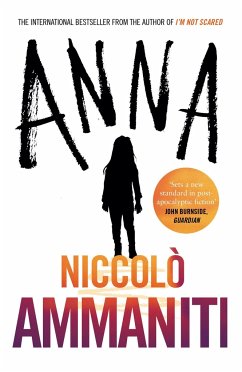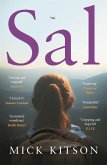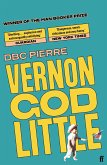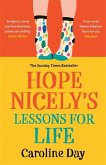It is four years since the virus came, killing every adult in its path. Not long after that the electricity failed. Food and water started running out. Fires raged across the country. Now Anna cares for her brother alone in a house hidden in the woods, keeping him safe from 'the Outside'. But, when the time comes, Anna knows they must leave their world and find another.
By turns luminous and tender, gripping and horrifying, Anna is a haunting parable of love and loneliness; of the stories we tell to sustain us, and the lengths we will go to in order to stay alive.
By turns luminous and tender, gripping and horrifying, Anna is a haunting parable of love and loneliness; of the stories we tell to sustain us, and the lengths we will go to in order to stay alive.

Nach der Apokalypse sieht die Welt schon ganz anders aus: Niccolò Ammanitis Roman "Anna" führt zwei Kinder ins Jahr 2020 und baut dabei auf eine Tradition, die bis zu Jules Verne zurückreicht.
Als der Schäferhund, den sie "Coccolone", also "Kuscheliger", getauft haben, in der Meerenge nun doch noch das Tretboot erreicht hat, in dem Anna und ihr Bruder Astor sitzen, als das Mädchen dann den halbtoten Hund endlich mühsam aus dem Wasser wuchtet und ihr vor Erleichterung fast die Tränen kommen, sagt sie spontan: "Ich könnte ihn heiraten." Der Hund sei "ihr Liebster", flüstert sie dem wehrlosen Tier ins Ohr und bedeckt Coccolone mit Küssen. Der kleine Astor aber fragt: "Geht das, einen Hund heiraten?"
Die Frage ist weniger absurd, als es scheint, nicht nur weil Astor es gewohnt ist, das zu akzeptieren, was seine fünf Jahre ältere Schwester über die Welt und deren Regelwerk verkündet. Sondern auch, weil so gut wie alles, was in dieser Hinsicht einmal galt, in dieser Situation auf dem Prüfstand steht. An diesem Punkt der Handlung von Niccolò Ammanitis Roman "Anna", der im italienischen Original 2015 erschienen ist und dieser Tage auf Deutsch erscheint, blicken die Kinder zurück auf eine Apokalypse, die mehr als vier Jahre zuvor über die Welt hereingebrochen war und, wie es scheint, alle Erwachsenen getötet hatte: Ein Virus, aus Belgien stammend, hatte sich 2016 rasend schnell verbreitet, dabei aber rätselhafterweise die Kinder verschont.
Nun, im Spätherbst 2020, schlagen sich die dreizehnjährige Anna und ihr achtjähriger Bruder im heimatlichen Nordsizilien durch. Die Bedingungen dafür sind vergleichsweise gut. Ihre Mutter war mit ihnen schon lange vor dem Ausbruch der "roten Seuche" in ein Landhaus bei Castellamare gezogen, wo sie einen großen Gemüsegarten angelegt hatte. Als die Katastrophe näher kam und klar wurde, dass es für die Erwachsenen kein Entkommen geben würde, fing sie an, den Kindern, vor allem aber der neunjährigen Anna, in einem Heft alles aufzuschreiben, was sie für das Überleben brauchen könnten, inklusive Anweisungen für den Umgang mit der Leiche, die sie bald sein würde. Über diesen Punkt allerdings setzt sich Anna hinweg: Sie sammelt die Knochen der Mutter ein, bemalt und schmückt sie und drapiert sie in der richtigen Ordnung im Elternschlafzimmer.
An solchen Stellen blitzt immer wieder das Interesse des Autors daran auf, wie sich die Kinder jenseits der Notwendigkeit des schieren Überlebens noch verhalten, wie sie dem Tag Struktur verleihen und woher sie etwa spirituellen Halt beziehen - das mütterliche Skelett, aufbewahrt in einem verschlossenen Zimmer und dem allgegenwärtigen Verfall entzogen, fungiert als Symbol einer besseren Zeit, in der die Kinder ihr Schicksal komplett bei den Erwachsenen aufgehoben wussten. Und der bizarre Kult einer gewalttätigen Jugendgruppe, in dem überall zusammengeraffte Knochen eine wesentliche Rolle bei der erhofften magischen Rettung vor der Seuche spielen, stellt die Nachtseite dieser Orientierungssuche dar.
Insgesamt steht "Anna" in einer literarischen Tradition, die mindestens bis Jules Vernes "Zwei Jahre Ferien" (1888) zurückreicht und so unterschiedliche Werke wie William Goldings "Herr der Fliegen" (1954) und John Christophers "Leere Welt" (1977) umfasst. In ihr sind Kinder und Jugendliche jäh auf sich allein gestellt, um in einer von Erwachsenen geprägten, nun aber von diesen entblößten Kultur zu überleben und darüber zu entscheiden, welche Traditionen sie fortführen wollen und welche nicht. Die Welt, in der sie sich bewegen, liefert Anlass genug für solche Überlegungen, schon durch die allgegenwärtigen Relikte aus der Zeit vor der Apokalypse und die Verheerungen in den folgenden vier Jahren: "Jetzt, nach den Plünderungen und Bränden, blieben von den hübschen Häusern im mediterranen Stil nur noch die Wandpfeiler aus Beton, dazu haufenweise Ziegel, Schutt und rostige Gittertüren. Bei Häusern, die das Feuer verschont hatte, waren die Türen aus den Angeln gerissen, die Scheiben zerbrochen und die Mauern voller Graffiti. Auf den Straßen lagen die winzigen, stumpfen Glasstücke zerplatzter Autoscheiben." Und während der Asphalt in der Hitze riesige Blasen geworfen hat, ist zugleich "das große Schild mit der lila Languste des Restaurants ,Il gusto di Afrodite' intakt geblieben", wie um daran zu erinnern, dass es einmal eine arbeitsteilige Gesellschaft gegeben hat, eine, in der man sich einfach zum Essen setzen konnte, ohne vorher die Zutaten erbeutet und zubereitet zu haben, und ohne Furcht davor, gewaltsam um diese Mahlzeit oder wegen ihr ums Leben gebracht zu werden. Zudem nehmen mit dem jähen Ende der Elektrizität auch die Geräusche ab, und vieles Gewohnte verliert nun seinen Sinn, auch für diejenigen, die etwa Straßenverkehr oder Radiomusik noch gekannt haben: "Anna war immer ein gesprächiges Kind gewesen. Jetzt füllte sich ihr Mund mit Wörtern, mit denen sie nichts anzufangen wusste."
Niccolò Ammaniti wurde mit dem Roman "Ich habe keine Angst" berühmt, in dem er mit großer Präzision die Psyche eines Jungen schildert, der sich gegen die Erwachsenen seines Dorfs stellt, weil er sich mit einem Gleichaltrigen identifiziert, der von ihnen entführt wurde und umgebracht werden soll. Auch in "Anna" gilt das Interesse des Autors spürbar der besonderen Perspektive der Kinder, und da vor allem der einer Titelheldin, die schwer an der Verantwortung für den Bruder trägt und kaum dazu kommt, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Sie ist hart geworden und zögert nicht, mit großer Wucht zuzuschlagen, wenn es um ihr Überleben oder das ihres Bruders geht. Wenn es sein muss, hält sie für Astor willkürlich terminierte "Weihnachtsfeiern" ab, um ihm unangenehme Entscheidungen schmackhaft zu machen. Und sie erfindet für ihn eine private Mythologie um einen zornigen Gott namens "Danone", um den Bruder davon abzuhalten, das rettende Gehöft zu verlassen. Das funktioniert so lange, bis eine marodierende Kinderbande kommt und dem Bruder auf drastische Weise klarmacht, dass er all die Jahre getäuscht worden ist.
Ammaniti erzählt seine Geschichte spannend und deutlich visuell, einer späteren Verfilmung wäre die Bahn durchaus bereitet. Von seiner Heldin sagt er, sie müsse einfach "hinsehen", auch auf das Entsetzliche, und er beschreibt dann eben so ungeschönt, was sie sieht. Er flicht Kleinkapitel ein, die den Hintergrund einzelner Figuren beleuchten und dabei im Detail aufzeigen, was für eine Welt da untergegangen ist und wie lange ihre Bewohner diesen Untergang nicht wahrhaben wollten. Eine Welt zudem, deren Kultur Sumpfblüten hervorgebracht hat wie einen kümmerlichen Möchtegern-Rapper, der seinen Hund zur Kampfmaschine erzieht. Auch das gehört zur Zivilisation, der Anna und Astor entstammen, aber nun, wo die Gesellschaft dramatisch geschrumpft ist, können die wenigen, die übrig sind, die Regeln des Zusammenlebens neu aushandeln.
Geht das also, einen Hund heiraten? Annas kleiner Bruder scheint nicht nur einverstanden damit, er hat sogar noch weiter reichende Pläne. "Ich will ihn auch heiraten", sagt Astor. Und Anna antwortet: "Ist gut. Wir heiraten ihn alle beide."
TILMAN SPRECKELSEN
Niccolò Ammaniti: "Anna".
Roman.
Aus dem Italienischen von Luis Ruby. Eisele Verlag, München 2018. 336 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Ammaniti sets a new standard in post-apocalyptic fiction . . . This story of children running wild in Sicily brilliantly manipulates the usual models even as it transcends their limits . . . In the midst of wonderfully detailed disorder, one girl named Anna struggles to survive, fighting off feral dogs and crazed children and enduring one of recent literature's most nightmarish visions of hell on earth as she tries to feed and protect her young brother, Astor John Burnside Guardian