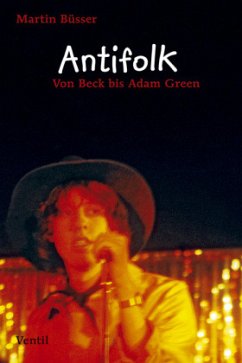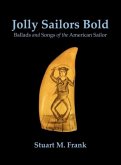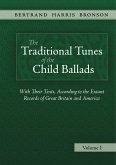"Wenn das Folk ist" soll der Songwriter Lach in den 1980ern ausgerufen haben; "Dann bin ich Antifolk!" Er gründete deshalb die "Open Mic Sessions", das auch Amateuren zugängliche "offene Mikrofon". In den 80ern machten Musiker wie Beck und Michelle Shocked dort ihre ersten musikalischen Gehversuche.Bekannt wurde die Antifolk -Szene allerdings erst 2001 durch die Moldy Peaches und den enormen Erfolg von Adam Green. Deren schrullige Musik löste eine ganze Flut der Begeisterung aus - die "Zeit" widmete Antifolk einen Aufmacher im Feuilleton, der "Suhrkamp Verlag" veröffentlichte ein Buch mit Gedichten und Prosa von Adam Green.Doch wie ist die Szene entstanden? Wer sind ihre Protagonisten? Martin Büsser liefert das weltweit erste Antifolk-Kompendium, entstanden in Zusammenarbeit mit zahlreichen Musikern aus der Szene. Es gibt einen Abriss über die Folk-Entwicklung von Bob Dylan bis heute, beleuchtet den "Do-it-yourself-Gedanken des Antifolk und liefert zudem ein "Who's who" der Szene.

Martin Büsser untersucht die politische Aktualität von Antifolk
Wie viele alternative Musikbewegungen hat sich Antifolk erst dann als feste Größe in popkulturellen Debatten etablieren können, als das Phänomen selbst historisch zu werden begann. Höhepunkt der Begeisterung für die manchmal auch Naive Pop genannte Musikrichtung, die in den Neunzigern aus Protest gegen die bornierte Altherren-Attitüde des Folk entstanden ist und zu deren Vorläufern Jonathan Richman, Daniel Johnston und Moe Tucker von "Velvet Underground" zählen, waren die Konzerte der "Moldy Peaches" und deren einzige CD, die 2001 bei Rough Trade erschienen ist.
Kurz danach hatten sich die "Moldy Peaches" aufgelöst, und die wichtigsten Bandmitglieder, Kimya Dawson, Adam Green und Toby Goodshank, begaben sich auf sehr verschiedene Solopfade. Zerstört wurde damit, zumindest vorerst, ein Traum, der den kleinsten gemeinsamen Nenner von Antifolk ausgemacht hatte - eine ganz eigene Spielart der Utopie von der Überwindung der Entfremdung: die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft ohne Zwang, nach Verschiedenheit ohne Angst.
Wenn Antifolk heute auch außerhalb des Independentsektors ein Begriff ist, so liegt das an Adam Green, der mit seinen Alben "Friends of Mine" und "Gemstones" zum Shootingstar der Szene avanciert ist, obwohl (oder weil) er sich damit vom kompromißlosen Dilettantismus der meisten Antifolk-Künstler gelöst hat. Der Musikjournalist Martin Büsser nimmt den Wendepunkt, den Greens Solokarriere in der Geschichte von Antifolk markiert, zum Anlaß für einen Rückblick auf die Entwicklung der wohl sympathischsten Independent-Bewegung des späten zwanzigsten Jahrhunderts. Büssers Buch zeigt, wie sich in dieser Bewegung ästhetische und politische Radikalität mit scheinbarer Naivität und Niedlichkeit paaren. Vor allem bemüht sich der Autor um eine historische Situierung von Antifolk, dessen Wurzeln er bis in die sechziger Jahre zurückverfolgt.
Anders als der Name nahelegt, ist Antifolk kein bloßer Gegenentwurf zum Folk, sondern knüpft an dessen linke, basisdemokratische Wurzeln an. Manche Ahnen des politischen Folk wie Woody Guthrie und Pete Seeger werden von Antifolk-Songwritern bis heute verehrt. Hatte sich der politische Folk als Angriff auf den zur Teenager-Mode depravierten Rock 'n' Roll verstanden, ist Antifolk eine Antwort auf die Infantilisierung der Jugend als kommerzieller Zielgruppe. Diese Antwort ist ein durch und durch jugendfreies Plädoyer: Indem sie auf technische Perfektion, Tanzbarkeit, dumpfe Coolness und Slacker-Gehabe verzichten, erheben Künstler wie Kimya Dawson, Jeffrey Lewis und Turner Cody Einspruch gegen die Kolonisierung eines Lebensabschnitts, der angeblich in besonderem Maß von Offenheit, Experimentierfreude und unverkürzter Erfahrung geprägt sein soll.
Im Gegensatz zum politischen Folk, der einen Hang zum Programmatischen hatte, ist den Protagonisten von Antifolk alles Proklamatorische fremd. Wie kaum eine andere Musik speisen sich ihre Lieder aus persönlicher Erfahrung und verzichten konsequent auf Repräsentationsansprüche. Dawson, Lewis, Diane Cluck und andere nehmen ihre Alben im Schlafzimmer auf, assistiert von Familienmitgliedern und Freunden. Kimya Dawson läßt außerdem die Kinder, denen sie im Kinderladen ihrer Eltern begegnet, mitsingen. Bei ihren "Moldy Peaches"-Konzerten haben Adam Green und sie es sich zur Gewohnheit gemacht, jeden einzelnen im Publikum zu umarmen. Dawson bricht zu den eigenen Songs regelmäßig in Tränen aus, sammelt auf ihrer Internetseite Geld, um ihrer Mutter ein Hörgerät schenken zu können, und verkauft selbstbemalte T-Shirts mit der Aufschrift "Kimya Dawson loves me". Büsser zitiert eine Äußerung aus ihrem Internet-Tagebuch: "I don't know who the enemy is anymore. I don't know who to fight anymore. I don't know who to believe anymore. I believe in being nice. I am a soft rocker."
Die ersten drei Sätze mögen sich noch mit den Ideologemen der Generation X vereinbaren lassen - aber nett zu sein, niemanden verletzen zu wollen und sich die ganze Welt zum Freund zu wünschen, gilt als uncool und ist mit weitsichtiger Karriereplanung kaum vereinbar. Anders als die erschreckend harmlosen Songs von Jonathan Richman, der in den Siebzigern der schlimmste Feind des Rock-Publikums war, weil er in Kindergärten und Altersheimen auftrat und, wie Büsser es formuliert, "haarscharf am Christen-Pop vorbeischrammte", ist die Naivität von Antifolk grundiert von tiefer Traurigkeit. "I wanted to be a hippie, but I forgot how to love", lautet eine Zeile der "Moldy Peaches".
Als wichtigster Wegbereiter kann daher nicht Richman, sondern Daniel Johnston gelten, ein Schwergewicht in Jogginghose und Woolworth-Hemd, der ohne Anti-Depressiva keinen Auftritt bewältigt. Seine Songs hat er lange Zeit nur auf billigsten Tonbändern eingespielt, weil ihm jede nach 1950 entwickelte Technik als Teufelszeug gilt. Bei Konzerten läßt er sich von seinem Großvater begleiten, der die Musik des Enkels nach anfänglicher Abwehr bewundert. Büsser zeichnet ein differenziertes Bild dieses Charakters, der im Laufe seiner Karriere zur Kultfigur wurde. Seine Schüchternheit und Ungeselligkeit sind Johnstons Stärke und Schwäche; nicht zuletzt das macht ihn repräsentativ für die Antifolk-Bewegung.
Im schlimmsten Fall - Büsser verdrängt diese Einsicht keineswegs - verwechselt Antifolk Inkompetenz mit Spontaneität. Im besten Fall, in den melancholischen Balladen von Jeffrey Lewis oder den mit zitternder Stimme eingespielten, monotonen Songs von Kimya Dawson, wird Antifolk zum Angriff auf alle popkulturellen Hörgewohnheiten. Zu Recht schätzt Büsser die neuen Alben Adam Greens wegen ihrer ironischen Unverbindlichkeit skeptisch ein. Der Neigung zum Personenkult, der Green durch Auftritte bei Harald Schmidt und Stefan Raab nachgegeben hat, begegnet er durch Darstellung unbekannterer Künstler - "Prewar Yardsale" etwa, ein Duo, das seine Lieder mit dem Schlagen auf einer Abfalltonne begleitet, oder die "Baby Skins", die ihre Inspirationen aus der schulischen Musik-AG bezogen haben.
Wenn Büsser die Präsenz von Antifolk in der bürgerlichen Presse als Indiz für Vereinnahmung wertet, trifft er indes wohl nur einen Teil der Wahrheit. Tatsächlich ist es die Stärke dieser Musik, daß sie jenseits normierter Rezeptionsformen funktioniert und schüchterne, verstockte Charaktere anspricht, die jedem, auch "linkem" Gruppenzwang mit Angst begegnen. Wer Popmusik als Teil sozialer Praxis ernst nimmt, kommt an Büssers Studie sowenig vorbei wie an Antifolk selbst.
MAGNUS KLAUE
Martin Büsser: "Antifolk". Von Beck bis Adam Green. Ventil Verlag, Mainz 2005. 144 S., Abb., br., 9,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Magnus Klaue legt jedem, der "Popmusik als Teil sozialer Praxis ernst nimmt", die Lektüre von Martin Büssers Büchlein ans Herz - und die Platten der Antifolk-Protagonisten, von Daniel Johnston bis Kimya Dawson: Musik für Angsthasen, für "schüchterne, verstockte Charaktere", die weder linken noch kommerziell vermittelten jugendkulturellen Zwängen folgen wollen. Mit anderen Worten: Antifolk ist nicht einfach niedlich, wie man meinen könnte, wenn man Adam-Green-Platten hört, sondern wichtig. Warum, steht bei Büsser, der die Bewegung bis zurück zu Woodie Guthrie historisiert, ihre Entwicklung darstellt, ihre utopischen und resignatorischen Momente herausarbeitet, ihr Anliegen als "Einspruch gegen die Kolonisierung eines Lebensabschnitts" darstellt, dabei aber auch, wo nötig, aus kritischer Distanz auf die Bewegung blickt. Denn einen Fehler dürfe Antifolk nicht begehen: Nämlich "Inkompetenz mit Spontaneität" zu verwechseln, viel eher sollte es sämtliche "popkulturellen Hörgewohnheiten" angreifen. Eine überaus gelungene Darstellung.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH