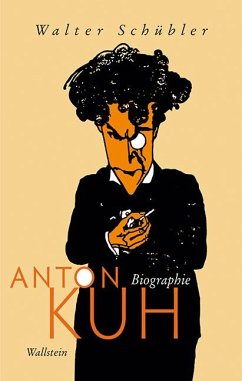Ein mitreißendes Porträt des bissigen Journalisten und launigen Bohemiens Anton Kuh.Walter Schüblers Biographie porträtiert den extravaganten Lebenskünstler Anton Kuh in all seinen Facetten: den streitbaren Publizisten, der die laufenden Wiener und Berliner Ereignisse mit polemischer Verve glossierte; den hellwachen Chronisten der 1910er, 1920er und 1930er Jahre; den bekennenden »Linksler«, der in der Auseinandersetzung mit den Nazis Kopf und Kragen riskierte; den »Gegenteils-Fex«, der sich einen Spaß daraus machte, Karl Kraus über Jahre zu frotzeln; den Bohemien, der - programmatisch taktlos - keine Gelegenheit ausließ zu provozieren; den aufgekratzten Neurastheniker, der geradezu selbstmörderisch lebte; den fulminanten Stegreif-Redner, der seine Gedankengänge heißlaufen ließ und damit sein Publikum zu Beifallsstürmen hinriss.Diese erste Biographie des »Sprechstellers« rekonstruiert auch dessen Hauptwerk - die Stegreif-Reden - und wirft alles über den Haufen, was an Gerüchten über die vermeintliche Wiener »Lokalgröße« immer noch kursiert.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Im Schauer der Gedankenblitze und Bonmots: Walter Schübler legt eine Biographie von Anton Kuh vor.
Von Daniela Strigl
Wie schreibt man die Biographie eines Autors, der an Geistesgegenwart, Witz und stilistischem Funkeln die meisten seiner Zunft- und Zeitgenossen überragte? Und der dennoch heute dazu verdammt scheint, das Etikett eines "Kaffeehausliteraten" und Kabarettisten zu tragen. Walter Schübler hat sich im Falle des Anton Kuh für das extensive Zitat entschieden. Wer immer Kuh kommentiert, kritisiert oder verunglimpft, vermittelt etwas von der "akustischen Atmosphäre" der Zeit, die den "Sprechsteller" aus Wien groß und dann wieder klein gemacht hat. "Auf den ,O-Ton' zu setzen, wenn Kuh am Wort ist, lag umso naher: Ihn zu referieren ist nicht annähernd so unterhaltsam wie ihn zu zitieren." Zum Beispiel: "Österreich: eine Schweiz der Komfortlosigkeit." - "Neue Generation: Sie wissen nicht, wo Gott wohnt, aber sie haben ihn alle schon interviewt." - "Wie sich der kleine Moritz die Weltgeschichte vorstellt - genau so ist sie!"
So soll diese Biographie, mit Lessing gesprochen, "nach den Quellen" schmecken, und das tut sie auch, was sie in der Tat unterhaltsam, mitunter hochkomisch, aber auch nicht ganz leicht verdaulich macht. Denn zum einen stellt die Dichte, in der Kuhs Gedankenblitze und Bonmots auf den Leser herniederprasseln, über die Distanz eine gewisse Herausforderung dar, zum anderen ist der Biograph selbst keineswegs ohne ästhetische Ambition, vielmehr ein von und mit seinem Gegenstand Begeisterter und Entflammter, der seinem Pegasus eher die Sporen gibt als eine Parade. Einige Sätze gehörten entschachtelt, auch hat das Lektorat wohl einige Wiederholungen übersehen, die überaus passende österreichische Sprach-Note indes nicht angetastet: Wir lesen "stier" (pleite), "entrisch" (unheimlich) und "Feber", allerdings nicht "Jänner", sondern "Januar".
Walter Schübler ist aber nicht nur ein geistreicher Schreiber, sondern vor allem ein Literaturwissenschaftler von stupendem Fleiß und enormer Akribie. Sieben Bände Kuh hat er bereits herausgegeben, 1500 Texte, von denen er vier Fünftel erst ausfindig machen und identifizieren musste (F.A.Z. vom 6. Januar 2017). Die Biographie ist so etwas wie der Schlussstein zu diese Werkedition, die Scharfsinn und Hellsicht eines großen Autors zugänglich macht, der mit dem mikroskopischen Monokel des Feuilletonisten die eigene Person in den Augen der Nachwelt paradox verkleinert hat. Geboren 1890 in Wien als Sohn eines aus Prag zugewanderten Journalisten, publizierte Kuh früh im "Prager Tagblatt", dann im "Frieden" und in der "Stunde" - das Blatt des erpresserischen Imre Békessy -, im "Berliner Tageblatt", im "Simplicissimus", in der "Weltbühne" und vielen anderen Blättern. 1926 übersiedelte er nach Berlin, von dort emigrierte er 1933 über Wien nach Paris und London, 1938 nach dem Anschluss Österreichs, den er in Wien erlebte, über Brünn nach New York, wo er 1941 an einem Herzinfarkt starb.
Zu Beginn skizziert der Biograph in einer "Personsbeschreibung" Kuhs Charakterkopf, am Ende versorgt eine prägnante Zeittafel den Leser mit dem, was man so Lebensstationen nennt. Dazwischen breitet Schübler mit Lust und Liebe und chronologischer Ordnung die Hauptfelder des Kuhschen OEuvres aus: das Feuilleton, die Theaterkritik, den Kaffeehausdisput, die Schauspielerei, insbesondere die überzeugende lebenslange Darstellung eines Dandys und Schnorrerkönigs, eines Bohemiens von volatilem Geist und ohne festen Wohnsitz (Kuh war sein Lebtag Hotelgast, seine Adresse zeitweilig "Wien, 1. Bezirk, Café Central"); und die Kunst der Stegreifrede, mit der Kuh, nach eigenem Befund als das "arithmetische Mittel aus Nietzsche und einem Bauchredner", ab 1917 von Prag bis Berlin die Säle füllte und von der naturgemäß kaum schriftliche Zeugnisse überliefert sind.
Das Setting immerhin ist bekannt: "ein Tisch, ein Stuhl, auf dem Tisch - ab Mitte der zwanziger Jahre - eine Flasche Kognak, manchmal ein Glas dazu, das er sich ab und zu randvoll einschenkt. Kuh nimmt Platz, redet sich warm, kommt in Bewegung, steht auf, steht hinter dem Stuhl, gestikuliert, geht dann anderthalb, zwei Stunden herum, sprechend, ringend, die Worte aus den Gesten schöpfend", immer wieder "unterbrochen von spontanem Beifall, von Zeit zu Zeit ein Zwischenruf, der schlagfertig pariert wird".
Ganze zweieinhalb Stunden dauert Kuhs von Tumulten begleitete Abrechnung mit Karl Kraus und seinen Jüngern 1925 im Wiener Konzerthaus, die unter dem Titel "Der Affe Zarathustras" ausnahmsweise auch gedruckt wird. Unter den Fehden, die der Biograph minutiös, belegreich und um Fairness bemüht nachzeichnet, ist jene mit dem "unglückseligen Amokläufer des Wortes" nicht nur die bekannteste, sondern auch die ergiebigste. Der jahrelang geübte "Unterhaltungssport" der "Frotzelung des Kraus" -, getreu Kuhs Devise "Nur nicht gleich sachlich werden! Es geht ja auch persönlich" - enthüllt Charakterzüge des einen wie des anderen. Es ist Kraus' sakrosankte Urteilsmacht und ihre hysterische Anbetung, die den "Gegenteils-Fex" und "notorischen Spielverderber" (Eigendefinition) fuchtig macht. Daraus wird der Schlagabtausch zweier Wiener Juden, die ihr Waffenarsenal bedenkenlos vom antisemitischen Diskurs der Zeit borgen, während ihre gemeinsamen Gegner aufrüsten.
Schübler zeigt eindrücklich, wie der "physiologisch linksstehende Mensch" (Kuh über Kuh) dem Rechtsdrall mit immer größerer Deutlichkeit entgegentritt, unter Verzicht auf das, was sein Publikum von ihm erwartet: Witzakrobatik. 1932, zum hundertsten Todestag des Dichterfürsten, betitelt er seine Vorträge mit "Was würde Goethe dazu sagen" und "Goethe und die Reichspräsidentenwahl". Noch widerlicher als das deutsche Pflaster erscheint Kuh das unberechenbare Wiener Parkett, wobei ihm ein anderes Metaphernfeld näher liegt: "Wenn schon Reaktion, dann lieber Asphalt und nicht Dreck." In einem Milieu durchaus praktizierter Handgreiflichkeit wusste der Polemiker zu differenzieren: "Eine Ohrfeige darf nichts als das klatschende Endglied einer Kette unausgesprochener, schlüssiger Argumente sein. Wenn sie nicht wie ein Bonmot zündet, gehört sie vors Bezirksgericht."
Naturgemäß weniger als für das Literarische und das Politische interessiert Schübler sich für Anton Kuhs Privatleben. Immerhin ist die Rede von der Auflösung einer Verlobung im Jahr 1919 - Kuh war der jungen Frau aus dem Umkreis Peter Altenbergs ein gar zu unzuverlässiger Patron - und en passant auch von einer späten Heirat im New Yorker Exil. Die Frau ist zwanzig Jahre jünger und heißt Thea Tausig, "geb. Goldmann" oder "geb. Sahavi", so genau weiß man das offenbar nicht. Ansonsten deutet Schübler an, dass Kuh sein aufklärerisches Engagement für die "Sachlichkeit der Triebe" im Sinne des anarchistischen Psychoanalytikers Otto Gross nicht nur in Vorträgen ("Die sexuelle Revolution") vertreten habe. Geradezu nonchalant, sozusagen in Klammern, erwähnt er Kuhs "in jungen Jahren (auch) gelebte Homosexualität", auf die Kraus mit den Worten eines persiflierten Kraus-Gegners ziemlich plump angespielt habe: "Ich komme von rückwärts gegen ihn, da kenn ich mich aus!" Und das obwohl er sich einiges darauf zugutehielt, private Blößen seiner Kontrahenten nicht öffentlich auszustellen. "Ethospetetos" nannte Kuh solche Moralverdopplung.
Walter Schübler: "Anton Kuh". Biographie.
Wallstein Verlag, Göttingen 2018.
572 S., Abb., geb., 34,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Daniela Strigl erfährt in Walter Schüblers Biografie über den Wiener Feuilletonisten und Stegreifbonmotisten Anton Kuh wenig Privates, dafür umso mehr über Kuhs Arbeit. Auch wenn Schübler das hochachtungsvolle Zitieren der Kuhschen Gedankenblitze laut Strigl mitunter etwas übertreibt, seine chronologische und literaturwissenschaftlich bewanderte Sicht auf das Werk verschafft ihr Erkenntnis und Freude. Kuhs Fehden mit Karl Kraus, sein Einsatz gegen die politische Rechte im Wien der 30er Jahre, sein Scharfsinn und seine Hellsicht versetzen die Rezensentin ins Staunen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Walter Schübler, Autor einer großen Biografie, tritt glücklicherweise hinter den Porträtierten zurück« (Fabian Wolff, Süddeutsche Zeitung, 27.11.2018) »Walter Schübler ist (...) nicht nur ein geistreicher Schreiber, sondern vor allem ein Literaturwissenschaftler von stupendem Fleiß und enormer Akribie.« (Daniela Strigl, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.11.2018) »ein intellektuelles Panorama« (Thomas Miessgang, Die ZEIT Österreich, 13.12.2018) »ein ungemein anregendes Buch (Ronald Pohl, Der Standard, 22.11.2018) »Walter Schübler zeigt (...), dass Anton Kuh keine unbedeutende Lokalgröße oder ein politisches Leichtgewicht war.« (scilog.fwf.ac.at, 04.06.2018) »eine hervorragende philologisch-historisch-biographische Leistung, die weit über das Modell der Lebensbeschreibung eines einzelnen Menschen hinausgeht. Ein in jeder Hinsicht imponierendes Werk« (Hubert Lengauer, literaturhaus.at, 07.01.2019) »Walter Schübler versteht es aus diesen Äußerungen und den Reaktionen darauf ein beeindruckendes und genaues Zeitbild zu entwerfen.« (SAXLiteratur, Februar 2019) »Eine (...) mustergültige Biographie« (Erich Klein, Anzeiger/27, Februar 2019) »Eine äußerst lesenswerte Biographie« (Paul Hübscher, literatur.ch, 17.02.2019) »Walter Schübler schafft es schon auf den ersten Seiten seiner exzellent recherchierten Biographie, Anton Kuh plastisch und eindrucksvoll zu porträtieren.« (Stefan Tuczek, literaturkritik.de, März 2019) »Die Biografie von Walter Schübler ist spannend, urkomisch, stellenweise unübersichtlich, manchmal kompliziert und immer sehr inspirierend.« (Wolfgang Luef, Süddeutsche Zeitung Österreich Newsletter, 30.04.2019) »eine gewitzte, sprachlich souveräne Biografie.« (Alfred Pfoser, Falter, 22.03.2019) »Großartig (...) anschaulich, lebendig, immer dicht dem Autor auf den Fersen« (Felix Klopotek, konkret, Juni 2019) »Nur die Meisterschaft des Arrangements kann (...) eine biographisch-bibliotgraphische Zeitreise zu einem Erlebnis werden lassen, das nach vollendeter Lektüre noch lange nachwirkt.« (Max Bloch, Exil, Nr. 1/2 2018)