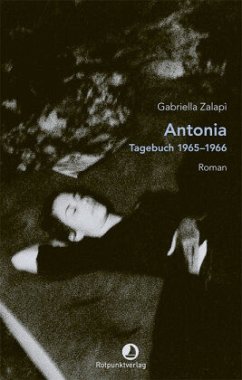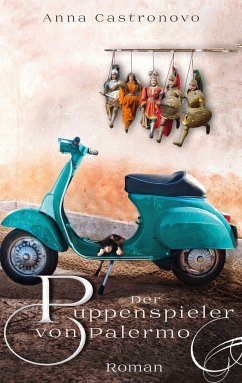Antonia lebt unglücklich verheiratet in Palermo, ihr kleiner Sohn, der einzige Hoffnungsschimmer, wird ihr entzogen. Als mit dem Tod der Nonna Familiendokumente in ihre Hände gelangen, verbringt sie ganze Tage und Nächte über alten Briefen, Zetteln und Fotos - und die Erinnerung spricht: Da war auf der einen Seite der jüdische Großvater, Kunstsammler, der in den Dreißigerjahren aus Wien geflohen ist, auf der anderen eine englische Familiendynastie in Sizilien. Die schwierige Kindheit und Jugend, zwischen Nassau auf den Bahamas, Kitzbühel und London. Der frühe Tod des Vaters. Die Mutter, die sich neu verheiratet und Antonia in Internaten oder bei der Großmutter in Genf deponiert.In Antonias Tagebuch wechseln aufkommende Erinnerungen mit Einträgen über ihren sizilianischen Alltag ab, der immer bedrückender wird. Bis sie schließlich den Mut fasst zu einem ungeheuerlichen Schritt.Gabriella Zalapìs Roman in Tagebuchform verknüpft eine atemberaubende kosmopolitische Familiengeschichte mit der Selbstbehauptung einer jungen Frau. Einfühlsame, fein abgestimmte Einträge und eingestreute Fotos machen die Veränderung greifbar.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Gabriella Zalapìs spezielle Autofiktion
Auch wenn er Biographie und Fiktion vermengt: Mit den wohlfeilen voyeuristischen Transgressionen vieler sogenannter Autofiktionen, die derzeit immer noch in Mode sind, hat dieser schmale Band nichts gemein. Es ist vielmehr eine eigenartige Mischung aus Familiengeschichte und Geschichtenerzählen, die Gabriella Zalapìs "Antonia - Tagebuch 1965-1966" auszeichnet.
Die Einträge der längeren Erzählung in Tagebuchform setzen im Februar 1965 ein und brechen im November 1966 ab. Dazwischen liegen zwei heiße Sommer in Palermo, unterbrochen von Reisen in die Schweiz, wo die zu Beginn neunundzwanzigjährige Heldin Antonia ihren achtjährigen Sohn Arturo in eine Sommerschule bringt sowie Mutter und Großmutter besucht (1965) beziehungsweise umgeht (1966). Die Eckdaten stehen für Beginn und Ende eines Reflexions- und Reifeprozesses, der mit der Flucht aus einer unglücklichen Ehe, ja aus der eigenen Familie endet.
Nächtelang durchforstet Antonia Erinnerungsstücke, lässt die Vergangenheit der Familie Revue passieren, die als Juden flüchten musste. Zwangsweise denkt sie über ihr katastrophales Verhältnis zu ihrer Mutter nach, über den missbrauchenden Stiefvater, über eine großbürgerliche Familie, die neben Wohlstand vor allem Kälte auszeichnet. Der Schluss wirkt wie ein rettender Schnitt: Sie will den ungeliebten Ehemann Franco - "Er wollte einfach meinen Namen, die ruhmreiche Vergangenheit meiner Familie" - loswerden und wird mit einem jungen Mann nach Südamerika durchbrennen. Erlauben kann sie es sich, von ihrer Großmutter hat sie auch sechs Mietwohnungen in Florenz geerbt; in manchen Kreisen sind Krisen relativ.
Der Befreiungsprozess geht mit einer Absage an Rollenerwartungen einher, die ihr auch von liebenden Personen wie dem Großvater mit Nachdruck in Erinnerung gerufen werden. Am Anfang reagiert Antonia selbstkritisch, ja mit Verzweiflung darauf; ein starker Fokus liegt auf der Körperwahrnehmung in einer Atmosphäre, die klimatisch und menschlich feindselig ist: "Mein Körper schien sich in den Laken aufgelöst zu haben und schwamm in giftigem Schweiß." Im Laufe der Zeit jedoch setzt Antonia sich vehementer zur Wehr: "Ich muss die Passivität abtöten, ich muss die Reflexe der ergebenen Frau abtöten, ich muss mit dem Gewehr auf meine Unbeweglichkeit schießen."
Zalapì schöpft für ihren Erstling offenbar aus der eigenen Familiengeschichte; ihre Wurzeln sind kosmopolitisch wie die ihrer Heldin, sie hat einen Parcours zwischen Mailand (Geburtsort), Genf (Studium) und Paris (Wohnort) hinter sich. Die Erzählung illustrieren zudem private Schwarzweißfotografien, welche sie zu beglaubigen scheinen. Dennoch: Der Leser weiß nicht um den Wahrheitsgehalt und kann nicht einschätzen, in welchem Bezug Bericht und Bilder stehen; das macht zu einem guten Teil den Reiz von "Antonia" aus. Auch reduziert Zalapì das Pathos einer Selbstermächtigung durch knappe, genaue Schilderungen und einen unbarmherzigen Blick; schließlich erahnt man die Bildhauerin in der konkreten Körpersprache.
Zweifel hingegen regen sich bei Sinn und Umständen der Selbstbefreiung. Antonias Widerstand gegen die paternalistische Gesellschaft ist verständlich, die dargestellten Herren der Schöpfung bieten ein jämmerliches Bild. Dennoch wird man den Eindruck nicht los, dass Zalapìs Lösung der Komplexität der von ihr entworfenen Situation nicht vollauf gerecht wird. Quelle von Antonias Unglück ist das gestörte Verhältnis zur Mutter, die ihr das Scheitern der Ehe mit dem übergriffigen Stiefvater vorgeworfen und die Tochter ins Internat geschickt hat - das Kind als Sündenbock verkrachter Existenzen. Nun droht die eigene Flucht auf Kosten von Antonias Sohn zu gehen, denn sie will ihn beim Gatten und der kaltherzigen Nurse lassen, wo er vermutlich ein ungeliebtes Kind der Schande wäre. "Ob ich Arturo einen Brief schreiben soll?", lautet der letzte Satz, der entweder naiv ist oder zynisch. Ein weiteres verlassenes Kind: Was ist gewonnen? Die Freiheit einer Frau? Gewiss. Über deren Preis scheinen weder Heldin noch Autorin recht nachzudenken, und das ist etwas simpel.
NIKLAS BENDER
Gabriella Zalapì: "Antonia". Tagebuch 1965-1966. Roman.
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz. Rotpunktverlag, Zürich 2020. 118 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main