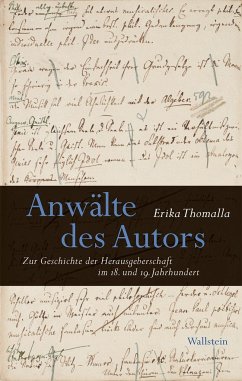Erika Thomalla schildert die Geschichte der modernen Herausgeberschaft vom frühen 18. bis zum späten 19. Jahrhundert.Gottsched, Lessing, Schlegel, Wieland oder Tieck waren nicht nur Autoren, sondern auch Herausgeber. Sie haben Texte von Freunden, unbekannten Nachwuchstalenten oder verstorbenen Schriftstellern bearbeitet und veröffentlicht. Sie nutzten Editionen als kulturpolitisches Kapital, etwa zur Empfehlung bei einem Patron, wie zur Bewerbung um eine Stelle am Hof oder an der Universität. Erika Thomalla erzählt die bisher ungeschriebene Geschichte der modernen Herausgeberschaft vom frühen 18. bis zum späten 19. Jahrhundert und zeigt, dass die Tätigkeit von Editoren in der neueren Literaturgeschichte alles andere als sekundär, sondern maßgeblich an der Konstitution eines nationalen Kanons sowie neuer Werk-, Autorschafts- und Literaturkonzepte beteiligt ist. Der Herausgeber ist die Instanz, die Texte auswählt, kürzt, umschreibt oder ergänzt, anordnet, rahmt, präsentiert, bekannt macht und zum Druck befördert. Erst durch solche editorialen Verfahren nimmt Geschriebenes jene scheinbar authentische überzeitliche Form an, die es als tradierungswürdigen, klassischen oder originellen Text lesbar macht. Herausgeber machen Texte allererst zu Werken eines Autors oder eines Autorenkollektivs.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Die höchste Instanz: Erika Thomalla untersucht die Geschichte und Bedeutung der Herausgeberschaft vom klassischen bis zum positivistischen Zeitalter.
Im Jahr 1865 rezensierte der Germanist Julius Zacher den ersten Band der von Franz Pfeiffer ins Leben gerufenen, explizit gegen kaum lesbare Professoren-Ausgaben der altdeutschen Literatur gerichteten, aus heutiger Sicht freilich hochkulturell anspruchsvollen Reihe "Deutsche Classiker des Mittelalters" im Brockhaus-Verlag. Eine Ausgabe ganz ohne Variantenapparat, das hielt Zacher für einen Kniefall vor dem Pöbel, der hier "die Bissen ... gekaut in den Mund" gelegt bekomme.
Nichts an diesem Verriss war zufällig, denn im Hintergrund tobte der sogenannte "Nibelungenstreit", in dem die zum Maßstab gewordene textkritische Editionsmethode Karl Lachmanns - philologische Vollständigkeit anstrebend, bei der Rekonstruktion eines vermeintlichen "Urtexts" aber befremdlich schöpferisch vorgehend - unter Beschuss von Philologen wie Pfeiffer kam, die bei aller Wissenschaftlichkeit etwa für erklärende Kommentare eintraten, um den mittelalterlichen Dichtern ihr modernes Publikum überhaupt erst zu erschließen. Die Berliner Lachmann-Schüler, darunter Zacher, verteidigten das elitäre Modell ihres 1851 gestorbenen Idols verbissen.
Dass sich Fachvertreter gegen die Popularisierung des von ihnen erforschten Gegenstands richten, ist nicht ungewöhnlich, aber hier gilt doch die Besonderheit, dass sich dieses Fach, die universitäre Germanistik, gerade erst konstituierte - und das geschah, wie sich jetzt bei Erika Thomalla nachlesen lässt, zu einem nicht geringen Teil über den ebenso erregten wie produktiven Austausch über Editionsfragen. Die Netzwerke im Hintergrund der Gemeinschaftseditionen zur mittelalterlichen Literatur im positivistischen Zeitalter erweisen sich als Keimzellen der Disziplin. Und als wollte die Berliner Literaturwissenschaftlerin noch einmal die Antithese von Lesbarkeit und Akkuratesse widerlegen, gehört ihre Studie - die erste, die in solcher Breite die Bedeutung von Herausgebern für die Entwicklung moderner Autorschaft im deutschsprachigen Raum untersucht - zu jenen eher raren Publikationen, in denen Fachkompetenz der Verständlichkeit nicht im Weg steht. Das Buch, das sich seinem Gegenstand geschickt über Grundsatzdebatten nähert, macht aber nicht nur deutlich, wie wichtig Editoren für die Etablierung der Universitätsgermanistik waren, sondern auch, wie sehr sie unseren Klassiker-Kanon geprägt haben. Qualität gab dabei nicht immer den Ausschlag.
Zunächst aber musste die dritte Instanz der publizistischen Trias (neben Autor und Verlag) überhaupt erst als eigenständige begriffen werden. Thomalla zeigt, wie sich aus der seit dem Humanismus weitgefassten Vermittlerrolle, nach der ein Herausgeber zugleich so etwas wie Lektor, Agent und Mitautor war, im neunzehnten Jahrhundert seine engere Bestimmung als "Anwalt des Autors" herausschälte. Urheberrechtlich blieb seine Stellung lange Zeit noch prekärer als die der Autoren, was seine literaturpolitische Macht aber keineswegs beschränkte: Ein Editor steuert(e) die Rezeption durch Auswahl, Bearbeitung und Paratexte wie Vorworte und Kommentare. Die Autorin kann zeigen, dass die Kontinuitäten in der editorischen Praxis dabei weit größer waren, als es das Narrativ von der umfänglichen Verwissenschaftlichung im Namen der Textkritik erwarten ließe. Auch wird um die Kernfrage schon von Beginn an gestritten: Wie sehr dürfen Herausgeber ihr Material bearbeiten?
Ramler, der Berüchtigte
Die erste der untersuchten großen Herausgeberschlachten fand Mitte des achtzehnten Jahrhunderts statt. Johann Christoph Gottsched, der aufgeklärte Regelpoetiker, hatte die Werke des galanten Dichters Benjamin Neukirch in einer preußisch modernisierten Variante ediert und dafür Kritik geerntet. Die ärgsten Gegner der Gottschedianer saßen bekanntlich in der Schweiz: Mit Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger, den Apologeten des "Wunderbaren", hielt das gegen den Rationalismus gerichtete Ideal der Demut vor dem Original Einzug ins Editionswesen - vorgeführt just an einer Ausgabe von Gottscheds Säulenheiligem Martin Opitz -, auch wenn sich Bodmer, wie Thomalla an seinen Editionen des "Codex Manesse" und des "Nibelungenlieds" belegt, durchaus Bearbeitungen der Textkorpora erlaubte. Die historisch-kritische Werkausgabe, das war zunächst einmal nur eine Idee. In der Praxis herrschte weiter vor allem die "Verbesserungsästhetik" vor.
Für Letzteres ist etwa der Aufklärungsdichter Karl Wilhelm Ramler berüchtigt, der zumindest partiell Gotthold Ephraim Lessing auf seiner Seite wusste, während Moses Mendelssohn "unbillige" Eingriffe zurückwies und sogar "Fehler" abgedruckt sehen wollte, weil dies den "Charakter" der Autoren ausmache. Es entsprach diesem Zeitgeist, dass nun Editionen aufkamen, die sich einer vermeintlich ungebildet natürlichen (Beispiel: Anna Louisa Karsch), einer verdeckt autobiographischen (Sophie von La Roche) oder der angeblich direkt der Volkskehle entstammenden Dichtung (der Kampf um das "Volkslied" zwischen Herder und Nicolai) verschrieben hatten. Dabei fuhrwerkten die Herausgeber so kräftig in ihrem Material herum, dass man von "Authentizitätsfiktion" sprechen darf: Natürlichkeit als rhetorische Spitzenleistung. Den gern ihre Spuren verwischt habenden Editoren kommt Thomalla mit kriminalistischem Gespür auf die Schliche. Ähnliches gilt für ein wichtiges romantisches Projekt: Die Autorin demonstriert, wie Schlegel und Tieck den von ihnen von 1802 an edierten Novalis durch Bearbeitung des Nachlasses als Fragmentdichter regelrecht erfunden haben.
Fragwürdige "Sophienausgabe"
Im späteren neunzehnten Jahrhundert, als die frühen Germanisten sich dem Mittelhochdeutschen zuwandten, standen disziplininterne Debatten über die historisch-kritischen Methoden im Vordergrund. Weiterhin gab es Konjekturen, dazu aber nun viel Pedanterie und Streit; die falsche Flexion Wolframs von Eschenbach, wie sie Thomalla zweimal unterläuft, hätte vor hundert Jahren wohl zu höhnischen Angriffen geführt. Vom allgemeinen Publikum hatte man sich verabschiedet. Historisch-kritische Werkausgaben taten sich hier in der Tat schwer, selbst wenn es sich um neuere Autoren handelte. Das wird anhand der formal vorausweisenden, textgenetischen Schiller-Ausgabe Karl Goedekes sowie der auf zu viele Interessen Rücksicht nehmenden Weimarer "Sophienausgabe" der Werke Goethes demonstriert. Damit ist die weitere Entwicklung angedeutet: der bis heute nicht überwundene Auseinanderfall in Studien- und Leseausgaben.
Obgleich es zu den von Thomalla untersuchten Debatten viele Einzelstudien gibt, macht erst eine solche Zusammenschau (ohne steile These) deutlich, dass die Funktionsstelle des Herausgebers für die literarische Traditionsbildung nicht nur bedeutsam, sondern maßgeblich war. Es ist lehrreich zu sehen, wie Editoren ihre ästhetischen Vorstellungen, die teils politisch oder ökonomisch motiviert waren, den edierten Autoren mitunter schamlos aufzwangen. Zugleich verdanken wir ihnen vieles, auch manche Verbesserung. Es wird Zeit, die Literaturanwälte neu wertzuschätzen.
OLIVER JUNGEN
Erika Thomalla: "Anwälte des Autors". Zur Geschichte der Herausgeberschaft im 18. und 19. Jahrhundert.
Wallstein Verlag,
Göttingen 2020.
518 S., geb., 59,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Oliver Jungen empfiehlt Erika Thomallas Studie zur Geschichte der Herausgeberschaft nicht nur Germanisten. So kenntnisreich wie anschaulich kann ihm die Berliner Literaturwissenschaftlerin vermitteln, wie bedeutsam die Figur des Herausgebers für die Etablierung der Universtätsgermanistik war, aber auch wie sehr Editoren den Klassiker-Kanon prägten. Mit großem Interesse liest Jungen von den "Herausgeberschlachten", die etwa zum vermeintlichen Gegensatz von Popularisierung und Wissenschaftlichkeit geführt wurden. Gespannt folgt der Rezensent zudem Thomallas geradezu "kriminalistischer" Spurensuche hinsichtlich der Bearbeitung und Veränderung, die Herausgeber häufig an ihrem Material vornahmen: So machten erst Schlegel und Tieck den von ihnen editierten Novalis zum Fragmentdichter, erfährt der Kritiker. Den Verzicht auf gewagte Thesen verzeiht Jungen mit Blick auf diese so lehr- wie umfangreiche Bündelung von Einzelstudien gern.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»(Erika Thomallas) Studie gehört (...) zu jenen eher raren Publikationen, in denen Fachkompetenz der Verständlichkeit nicht im Weg steht.« (Oliver Jungen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.02.2021) »Thomallas Untersuchung (gebührt) das große Verdienst, wichtige Felder und Entwicklungstendenzen editiorialer Praxis erschlossen zu haben. Künftige Forschungen in diesem Bereich sollten sich an dieser Studie ein Vorbild nehmen.« (Tobias Christ, Zeitschirft für Germanistik, 3/2022)