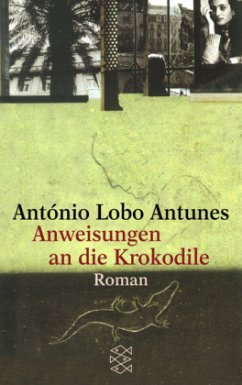Portugal, Mitte der siebziger Jahre: Die Terroristengruppe "Krokodile" plant einen Putsch. Doch der Plan kippt um in ein selbstmörderisches Chaos. Mimi, Celina, Fatima und Simone erzählen von ihrem Leben mit den Terroristen - aus ihren Monologen entstehen Lebensbilder aus Missachtung, unerfüllter Liebe, betrogener Sexualität im Schatten des Katholizismus. Dieser Roman schließt Antunes' Romantrilogie um Macht und die Geschichte Portugals ab.

Antunes' Reigen der Verdammten / Von Alexander Kissler
Was aber ist der Mensch? Die Molekularbiologie hält darauf eine Antwort bereit, die wie die Summe aus den Erfahrungen des zwanzigsten Jahrhunderts klingt. Der Homo sapiens, erklärte unlängst François Jacob, sei "eine zweifelhafte Mischung aus Nukleinsäuren und Erinnerungen, aus Begierden und Proteinen". Das kommende Jahrhundert werde sich vom gerade ablaufenden dadurch unterscheiden, dass es sich weniger mit den materiellen Bausteinen als mit den geistigen Prägungen zu beschäftigen habe. Die Erinnerungen und die Begierden also werden gefragt sein, wenn künftig die Vermessung des Menschen ansteht. Sollte der Biologe Recht behalten, ginge der neuen Zeit ihr Chronist voraus. Er wäre Chirurg, Psychiater, Schriftsteller, stammte aus Lissabon und hieße António Lobo Antunes.
Vierzig Jahre ist Celina alt, und was ihre Kosmetikerin allmorgendlich Mimikfalten nennt, kann nichts anderes sein als der schleichende Tod. "Du wirst sterben", hallt es der "Sekretärin auf Widerruf" aus dem Spiegel entgegen. Celina ist darauf nur einen Augenblick "schreckensstarr", dann sind ihre Gedanken wieder zu Fernando zurückgekehrt, dem verhassten Gatten. Dieser heiratete ein achtzehnjähriges Mädchen mit Namen Celina, das seine Tochter hätte sein können. Er ließ es fortan "in Fäulnis übergehen", raubte ihm "das wenige, was ich besessen hatte, meine Kindheit, meine Stofftiere".
Weder Mariana, die Puppe, noch eine reichlich lädierte Mickymaus überlebten den Umzug in die gemeinschaftliche Wohnung. Wann immer dort Fernando unter ihre Bettdecke kroch, fühlte Celina sich wie "eine Leiche im Leichenschauhaus". Den Beischlaf empfand sie als Obduktion. Gerne würde sie "die Zeit umstülpen wie einen Strumpf" und sowohl die Mimikfalten als auch die Ehe ungeschehen machen. Der Zauberer im Zirkuszelt aber, der vor dreieinhalb Jahrzehnten Miss Suzy zersägen und dann neu zusammensetzen konnte, ist längst gestorben. Celina muss selbst zur Tat schreiten, "um in ein paar Stunden mich an nichts mehr zu erinnern".
Das Glück der Amnesie suchen die Helden des António Lobo Antunes verbissen, aber vergeblich. Seit der Portugiese im Jahr 1979 einen ebenso sentimentalen wie zynischen Soldaten über die blutigen Kämpfe in der ehemaligen Kolonie Angola und den "Judaskuss" monologisieren ließ, arbeitet Antunes an seinem "Reigen der Verdammten". Der Buchtitel von 1985 sieht die in mittlerweile vierzehn Romanen porträtierte Schar der Versager und Verdränger, der feigen Sadisten und mutlosen Selbstmörder im Banne eines zerstörerischen Fatums. Der antunesische Kosmos ist "ein Universum dicht am Boden", aus dem nicht nur dem geistig zurückgebliebenen Epileptiker Rui kein Ausbruch gelingen kann. In "Portugals strahlende Größe", der vorletzten Expedition ins Unterholz des Bewusstseins, ist die Brutalität des kindlichen Gewalttäters ebenso an den Zwang zur Erinnerung gekoppelt, wie auch die vier Protagonistinnen des jüngsten Werks nur in der Rückschau über eine Existenz verfügen. Weder als Tempus noch als Gedanke ist Zukunft vorhanden.
Neben Rui nimmt Celina ihre Welt aus der Froschperspektive wahr: "Heute noch hocke ich unter dem Tisch." Sie bleibt "der Erde verhaftet" und deshalb "todunglücklich". Die Fünfjährige hingegen konnte fliegen, wenn der Onkel sie an der Taille fasste und "höher als die Erwachsenen, höher als die Möbel" hob. Bald zog der Onkel aus, weil sein Verhältnis mit Celinas Mutter eskalierte, und zurück blieb der wortkarge, jähzornige, berührungsscheue Vater. Mit dem Onkel verschwand auch das Geheimnis der zersägten Jungfrau, deren Hälften nie mehr sich zusammenfügen sollten. Celina weiß, sie muss endlich zur Tat schreiten.
Mimi, Fatima, Celina und Simone, aus deren je acht Selbstgesprächen die "Anweisungen an die Krokodile" bestehen, eint die Sehnsucht nach der Schwerelosigkeit und der fragmentierende Blick auf sich und ihre Umwelt. Ihnen ist die Fähigkeit abhanden gekommen, auch nur die geringste Vorstellung oder Erscheinung als isolierte Ganzheit wahrzunehmen. Jeder Gedanke, jedes Wort, jeder Gegenstand hängt mit abertausend anderen Gedanken, Worten, Gegenständen zusammen. Die Realität ist ein bloßes Stakkato der Nervenreize. Ob vergangene oder gegenwärtige Eindrücke dieses Trommelfeuer der Bilder in Gang setzen, lässt sich nicht entscheiden. Dass die "Satzlumpen" und "Mörsergeschossworte" kapitelweise einer der vier Perspektiven zugeordnet werden, führt planvoll in die Irre: Die "Anweisungen an die Krokodile" sind wie auch die vorherigen Romane Äußerung des einen Subjekts, des Menschen schlechthin.
Unzählige Male behauptet dieser, die Vergangenheit sei vielleicht der einzige Ort, an dem er sich wohl fühle, bestimmt aber der einzige Raum, in dem er sich auskenne. Immer wieder fallen "Erinnerungen mit der ziellosen Leichtigkeit von toten Schmetterlingen auf den Boden". Sie begraben mit der "Schaufel des Wortes" die Gegenwart unter sich und können doch nicht verbergen, dass sie die vergangene Realität weder abbilden noch bündeln, sondern zerstreuen. Was auch immer den abschüssigen Gang durch das menschliche Bewusstsein antritt, wird bruchstückhaft, entstellt, leblos an die Oberfläche der Äußerung gespült.
Die zahlreichen Zerstückelungsphantasien, denen die vier Frauen sich hingeben, entsprechen der Arbeitsweise des menschlichen Gehirns, das also keineswegs dazu geeignet scheint, eine Vergangenheit wach zu halten und hierdurch die Gegenwart meistern zu helfen. Stattdessen ist das zunehmend diffuse Erinnern von Mimi, Fatima, Celina und Simone der Effekt eines gewaltigen Schuldbewusstseins. Jede der vier Frauen schämt sich für ihre Gebrechen, ihren Ehebruch, ihr Alter, ihr Übergewicht; jede fühlt sich mitschuldig an den terroristischen Taten des Mannes, des Patenonkels, des Verlobten, die das gerade demokratisierte Portugal der siebziger Jahre "vor den Linken retten" wollen. Der Mensch, so lautet der gewohnt niederschmetternde Befund Antunes', muss Erinnerung fingieren, weil und so lange er sich schuldig fühlt. Die Geschichte ist eine Funktion der Erbsünde.
Keinen Ausweg gönnt der Romancier seinen Figuren. Sie bleiben starr unter dem Tisch gefangen, blinzeln nach oben und warten auf das Purgatorium der befreienden Tat, die Tod heißt. Doch dieser ist bereits im Hier und Jetzt derart allgegenwärtig, dass die Hoffnung, er könne kraftvoll eine nie gekannte Zukunft herbeizwingen, trügen muss. Die Männer spielen vor der Exekution mit ihren Opfern Karneval, die Frauen haben als Kinder Tiere gequält und lernten früh, wie man Lämmer schlachtet. Das Gedächtnis findet die Spuren des Todes sogar auf dem Heimweg der Schulmädchen, die einander belauerten und demütigten. Wo der Tod die Wiederkehr des Unabänderlichen garantiert, kann Individualität nicht gedeihen. Das Bewusstsein einer Schuld, einer menschheitsgeschichtlichen "Familienkrankheit", die schon Ruis Mutter für die sadistische Debilität ihres Sohnes verantwortlich machte, mündet in ein nicht nur fragmentierendes, sondern auch verdinglichendes Bewusstsein. Menschen sind Puppen, und Puppen sind Menschen, Dinge reden, und was redet, ist ein Ding. Nur das Leblose kann sich mitteilen, da alles Beseelte schon vom Tod infiziert ist. Ein kleiner kupferner Bär an Simones Kühlschrank hält "die Welt in der Schwebe", da er und nur er "ganz Lächeln" ist.
Zum Ding ist der Mensch geworden, seit sein Leben nur aus dem Nachvollzug dessen besteht, was vor ihm getan worden ist. Dutzendfach schließt Antunes die Verhaltensweisen von Vater und Ehemann, von Mutter und Tochter, von Geliebtem und Mörder kurz. Handlung findet statt, indem ein Muster aktualisiert wird, indem Langeweile, Ungeduld, Selbsthass sich unablässig reproduzieren. Abbild dieses endlosen Kreislaufs ist zum einen die Sprache, die hier stärker als zuvor aus vielen Kehrreimen und wenigen Strophen besteht. Die Imagination kommt über den einen Ausspruch, die eine Sehnsucht - "fliegen, Celina, fliegen" - nicht hinaus. Zum anderen kehren die aus dem Vorgänger und dem "Handbuch der Inquisitoren" bekannten Motive, Themen, Metaphern hier nahezu identisch wieder. Das gesamte Werk des António Lobo Antunes ist ein und dasselbe verstörende Gedankenexperiment, dessen großartige Monotonie die Grenzen der Zeit und der Person tragisch aufhebt. Die "zweifelhafte Mischung" namens Mensch hat mit den "Anweisungen an die Krokodile" einen gewaltigen Grabstein gefunden.
Celina schritt zur Tat, die nächtlichen Obduktionen durch Fernando haben ein Ende gefunden. Zusammen mit Mimi, mit Fatima und dem Rest der gescheiterten Terrorgruppe, dem General, dem Bischof, dem Offizier der Kriegsmarine, sitzt sie nun in der Villa im Kiefernwäldchen. Simone und ihr Verlobter hantieren draußen zwischen den Bäumen mit Kabeln und Drähten. Makellos wird Celina gleich sein, faltenfrei und schwerelos. Simone muss nur den Zündhebel nach unten drücken. Die Explosionen in Mimis, Fatimas, Celinas Kopf werden nichts zurück lassen außer vielleicht eine Karnevalsnase oder eine reichlich lädierte Stoffpuppe. Und Miss Suzy wird dem Sarg entsteigen als ein ganzer Mensch.
António Lobo Antunes: "Anweisungen an die Krokodile". Roman. Aus dem Portugiesischen übersetzt von Maralde Meyer-Minnemann. Luchterhand Verlag, München 1999. 441 S., geb., 48,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main