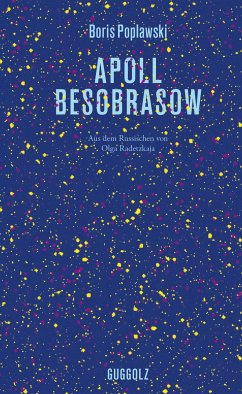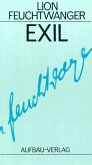Boris Poplawski (1903-1935) war in den Pariser russischen Exilkreisen vor allem als ausdrucksstarker Lyriker bekannt. Der Roman »Apoll Besobrasow« erzählt in gleißenden Bildern von einigen entwurzelten jungen Menschen - meist russischen Emigranten -, die sich torkelnd und tanzend durch Paris treiben lassen und der Kunstwerdung ihres eigenen Lebens widmen. Der Ich-Erzähler Wassili lernt den geheimnisumwitterten Apoll Besobrasow kennen, der voller Widersprüche, aber auch von enormer Anziehungskraft für ihn ist. Beide sind verlorene Existenzen, die nach Schönheit und Aufrichtigkeit streben, beide schlagen sich durch und deuten ihre Zukunftslosigkeit zu Freiheit um. Russland gehört der Vergangenheit an, Frankreich bleibt ihnen fremd - die Nichtzugehörigkeit des Dazwischen versetzt den Roman in einen ambivalenten Schwebezustand. Doch die selbstgewählte Isolation treibt giftige Blüten, auf die Euphorie der Freiheit droht ein tiefer Absturz zu folgen.Die von der Lyrik geprägte Sprache reizt die Imaginationskraft des Lesers mit ihrer hypertrophen Farbenpracht bis zum Überschäumen - und weist mit futuristischen und surrealistischen Einflüssen, mit den ausgiebig erforschten Rauschzuständen und der radikal antibürgerlichen Attitüde der Figuren wie ein früher Vorläufer auf die späteren Beatpoeten voraus. Olga Radetzkajas Übersetzung arbeitet mit feinem Gespür die Zwischen- und Untertöne in den grellen Formulierungen und kraftvollen Bildern heraus. Sie bringt die den Figuren eingeschriebene Verlorenheit und tiefe Traurigkeit des Exils, die auch hundert Jahre später noch Gültigkeit haben, zum Leuchten.

Boris Poplawskis Roman "Apoll Besobrasow" erzählt vom prekären Leben russischer Emigranten in Paris
Vladimir Nabokov, der Boris Poplawski nur aus Erzählungen kannte, beschreibt ihn in seinen Erinnerungen als eine "ferne Geige unter lauter nahen Balalaikas". Dieser exzentrischste unter den jüngeren Russen, der mit nur zweiunddreißig Jahren an einer Drogenüberdosis starb, war kein literarischer Eintänzer in der "russischen Kunstkolonie" Montparnasse. Er war keiner, der Akkorde zu herzzerreißenden Melodien spielte. Mit seinem Sprachorgan konnte er schluchzende und zarte, nervtötende und wohlklingende Töne hervorzaubern. In seinem Todesjahr 1935 hatte er allerdings nur einen einzigen Lyrikband veröffentlicht. Einzelne verstreute Romankapitel seines erst sechzig Jahre später vollständig veröffentlichten Romans "Apoll Besobrasow" waren aber damals durchaus in der Exilpresse zu lesen.
Poplawski, der Russland als Pubertierender über Jalta, Konstantinopel und Marseille verlässt, ist eigentlich Maler. Anfang der zwanziger Jahre reist er von Paris nach Berlin. Dort trifft er unter anderem Boris Pasternak. Danach beschließt er, nur noch zu schreiben. Und daran hält er sich. Das, was er schreibt, hat allerdings mit Malerei einiges zu tun. Für den damals wie heute marktgängigen realistischen Roman zeigte Poplawski jedenfalls wenig Interesse. Das Emigrantentaxi fahre ohne Umschweife "über den Dostojewski-Prospekt zum Tolstoj-Platz", spottete er gelegentlich.
1903 geboren gehörte Poplawski zu einer äußerst problematischen Exilantengeneration. Olga Radetzkaja, seine Übersetzerin, weist im Nachwort darauf hin. Er war, wie der ebenfalls spät entdeckte Gaito Gasdanow, zu jung, um schon von heimischer Berühmtheit zu zehren. Gleichzeitig war er bei der Flucht aus Russland schon zu alt, um das Trauma des Heimatverlustes nicht zu erleiden. "Apoll Besobrasow" ist oberflächlich betrachtet der Roman über eine Gruppe junger Exilrussen, die sich zwischen saturnischer Trägheit und exzentrischer Überspanntheit durch eine Stadt treiben lassen, in der sie als Außenseiter nicht wirklich leben können und nicht einmal die stille Würde der einheimischen Clochards besitzen.
Taxifahren (wie Gasdanow) oder Avantgardist sein, das waren zwei Möglichkeiten, die beide keinen Ausweg aus der oft drückenden Armut boten. Vielleicht ist es nicht ganz falsch, sich vor Augen zu führen, dass es vielen Flüchtlingen heute in Europa ähnlich ergehen mag. Sie wissen sich einerseits in Sicherheit und andererseits an der Entfaltung ihres Lebens gehindert. Gefangen in einer zweifelhaften Freiheit. Was soll man also tun?
Auch die jungen Leute um den Charismatiker "Apoll Besobrasow" wirken abgeschnitten von einer goldenen Vergangenheit und sind ohne annehmbare Zukunft. "Ich lud Waggons aus, überwachte Maschinen mit rasend schnellen Triebrädern, tauchte hysterisch zuckend Hunderte und Aberhunderte schmutzige Restaurantteller in kochendes Wasser. Sonntags schlief ich in einem billigen neuen Anzug und Schuhen von unanständig gelber Farbe auf dem Gras der ehemaligen Befestigungsanlagen. Später schlief ich einfach auf Bänken und, wenn meine Bekannten zur Arbeit gingen, auf ihren zerwühlten Hotelbetten in der Tiefe grauer, heißer, tuberkulöser Zimmer." Wassenka, der Ich-Erzähler, war vor kurzem erst in die Stadt gekommen. Seine Erscheinung, berichtet er, "trug den Ausdruck irgendeiner transzendentalen Erniedrigung".
Paris erscheint in diesem fiebrigen Roman nicht wie eine höhere Organisationsform der Zivilisation, sondern wie ein verwurmter Organismus voller übler Gerüche, Geräusche und Geschmäcker. Poplawski führt seine Leser außerdem in ein Delirium ständig wechselnder Farben. "Der Himmel war jetzt tiefblau, das Wasser schwarz, der Mond weiß und unsere Gesichter dunkelgrau." Seitenlang zieht uns Wassenka als Nemesis des athletisch-asketischen Apoll in die Opiumhöhlen der Stadt. Haufenweisen liegen die Leute in ihrem Erbrochenen. Irgendjemand findet sich immer, der den Unglücklichen eine Zitronenscheibe zwischen die Kiefer klemmt. Dann wird wieder aufgespielt, getanzt, kopuliert und deliriert. "O Ball! Du bist wie ein langer Tag, wie das Leben, wie ein musikalisches Ganzes, unteilbar in notwendige Äonen und doch gegliedert in lyrische Perioden, als da wären: die kalte Introduktion, die gymnastische Animation, die tänzerische Exaltation, die alkoholische Intoxination, die verbale Stimulation, die sexuelle Satisfaktion und die morgendliche Meditation."
In einer dieser endlosen und durch ihre Endlosigkeit mythischen Nächte lernen Apoll und Wassenka die anämische Thérèse von Blitzenstyff kennen. Im mittleren Teil des Buchs wird ihre Geschichte erzählt. Nämlich die einer Klosterschülerin, die einem jungen Priester den Kopf verdreht, bis schließlich beide aus Saint-Morancy entfernt werden. So landet Thérèse auf der Straße und bildet von nun an die Spitze eines Freundschaftsdreiecks, zu dem sich noch eine bäuerliche Zeus-Gestalt namens Tichon gesellt sowie ein Blumenladen-Besitzer, der den Namen des Aristoteles-Kommentators Averroes trägt.
Man wohnt in einer verlassenen Stadtvilla und später in einem Schloss am Gardasee. Apoll wird als Asket beschrieben, der sich in geistigen und körperlichen Exerzitien übt. Ein Vorläufer von Becketts Murphy, der stundenlang ein und dasselbe mit dem Finger auf einen staubigen Spiegel geschriebene Wort studiert. Er ist überaus gebildet. "Doch in den Büchern standen entweder Dinge, die er schon wusste, oder solche, mit denen er nicht einverstanden war." Als Freund von Thérèse und Wassenka agiert er treu, aber gleichzeitig unabhängig wie ein von weltlichen Dingen detachierter Geist.
Alle Figuren scheinen entweder in suizidaler Schläfrigkeit nebeneinander herzuleben oder Backgammon spielend auf einen gemeinsamen Persönlichkeitskern zuzulaufen. Sie sind, auch das legt das Nachwort nah, die Facetten eines Autors, der im Paris der Zwischenkriegsjahre Zuflucht bei Mythologie, Philosophie, Theologie, Alchemie, religiöser Mystik und weltlicher Ekstase suchte, um seinen Platz im Leben zu finden - und der sich dabei tödlich verbrauchte.
"Wenn ich auf die verflogenen Jahre zurückblicke, sehe ich fast keine Ereignisse", sagt der Erzähler einmal. "Das Leben besteht aus Atmosphären." Gleiches lässt sich über dieses Buch sagen. Es ist ein Enkel symbolistischer Sprachwelten, die ihren eigenen Mythos vom Leben jenseits des Lebens begründen. Doch "Apoll Besobrasow" trägt auch den Streifschuss des Surrealismus als sehr französische Signatur. Dazu passt, dass sein früher Tod bis heute Legenden bildet. Von Suizid über Mord ist alles dabei. Der Slawist Alexander Goldstein phantasierte in der "Lettre International", Poplawski habe seinen Tod nur vorgetäuscht und sei bei Pasolinis Filmset von "Die 120 Tage von Sodom" aufgetaucht. Sicher ist eigentlich nur dies: Der Guggolz Verlag hat diesen schillernden Paris-Roman jetzt auch für eine deutsche Leserschaft endlich zum Leben erweckt.
KATHARINA TEUTSCH
Boris Poplawski: "Apoll Besobrasow".
Aus dem Russischen, mit Anmerkungen und Nachwort von Olga Radetzkaja. Guggolz Verlag, Berlin 2019. 296 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main