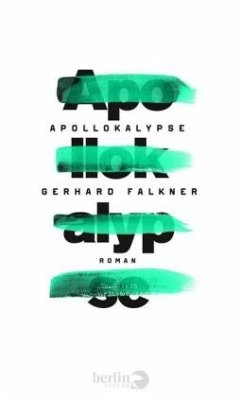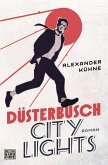Georg Autenrieth ist eine zwielichtige Gestalt in zwiegesichtigen Zeiten, immer wieder taucht er auf in Berlin, der Mann aus Westdeutschland, hält Kontakt mit der Szene, durchsucht die Stadt und zelebriert Laster, Lebensgier und Liebeskunst. Wohin aber verschwindet er dann? Wer ist der "Glasmann"? Und welche Rolle spielen seine Verbindungen zur RAF? Gerhard Falkners "Apollokalypse" ist ein Epochenroman über die 80er und 90er Jahre. Dem Vergeuden von Jugend, der Ausschweifung jeglicher Couleur und der Hypermobilität stellt er einen rauschhaften Rückverzauberungsversuch der Welt entgegen. Bulgakows Meister und Margarita begegnet dem Ferdydurke von Gombrowicz und Oskar Matzerath schrammt an Tyron Slothrop, Bruno Schulz und Wilhelm Meister. Die Hauptrolle spielt die Stadt Berlin selbst, haufenweise gehen Künstlerexistenzen an ihrer magischen Gestalt in die Brüche. Und wenn die RAF sich über den BND mit der Stasi berührt, gerät die Zeitgeschichte unter das Messer der Psychiatrie. Am Schluss nimmt der Teufel leibhaftig das Heft in die Hand. Ein mythologischer Roman von unvergleichlicher Sprachmächtigkeit.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Einen bildmächtigen Text hat Michael Braun mit Gerhard Falkners Debütroman zu annoncieren, einen mythologischen Berlin-Roman, eine abenteuerliche Reise durch die Wendezeit. Vor allem über den vielgesichtigen Helden lässt sich Braun lustvoll aus. Wie der die Ära als Mischung aus sexueller Ausschweifung und brutaler Ernüchterung erlebt, findet Braun lesenswert. Zumal der Autor sprachlich geschickt vorgeht, wie Braun meint, poetische, neoexpressionistische oder burlesk überzeichnete Großstadtbilder erfindet und sich statt auf politische Deutungen auf Obsessionen konzentriert. Für Braun eine klare Leseempfehlung.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Sexbesessene Raserei: Gerhard Falkners Roman "Apollokalypse" lässt das aus der Zeit gefallene Berlin der Wendezeit opulent wiederauferstehen.
Die einstige Welthauptstadt der Negation hat es schwer getroffen. Aus dem Dark Room der Ideologie wurde ein pummelgesunder Touristenspielplatz mit einer Literatur, die man niemandem wünscht. Während in New York ein Virtuose wie Jonathan Lethem den Mythos der Stadt am offenen Herzen operierte, wurde das neue Berlin von sogenannten Popliteraten breitgelatscht. Der Rückstand aber scheint allmählich aufgeholt zu werden. So legt Gerhard Falkner, mit Herz und Rhythmus Lyriker, also ein Sezierer, jetzt einen Roman über die "lost years" der deutsch-deutschen Hauptstadt vor - die achtziger und neunziger Jahre -, für den man ihn mit Recht als neuen Mythopoeten Berlins ansehen darf.
Es reißt einen in die eigenen Erinnerungen zurück, dieses sprudelnde, überbordende Buch, in dem ein Doppelgänger des Autors seinen irgendwie allegorischen Helden durch die Niederungen der Identitätssuche führt und dabei das doppelgesichtige Berlin retrospektiv so genau vermisst, dass der verblasste (und ein wenig auch klebrige) Mythos der Zerrissenheit für einen Moment wieder seinen alten Glanz erhält. Hier ersteht der Osten noch einmal in seiner ganzen Pracht, "geronnen wie altes Blut", "ein deutsches Pompeji": "Die meisten Leute, denen ich begegnete, sahen aus, als ob sie steckbrieflich gesucht würden . . . Abgeblättertes, aufplatzendes, ungeschöntes, ruchloses Wohnmaterial erhob sich längs der Straßen, ohne Farbe . . . Sogar der Himmel sah aus, als hätte man ihn im Neuen Deutschland gedruckt."
Gespiegelt wird diese herrliche Kaputtheit vom bordellhaften Westen mit seinen Billigläden, "die sich mit ihrem Gekröse auf die Gehsteige ergossen. Wie Soldaten nach dem Bauchschuss." Dazu die Clubs, das Konspirative, der geistige Hedonismus und der Sex. Auf vier Worte gebracht: "Berlin bot außerplanmäßiges Existieren."
Der beherzte Kopfsprung in die Frontstadt des Wahnsinns beginnt trotz des nicht ganz greifbaren Ich-Erzählers, der in kreisenden Erinnerungen zurückblickt, vergleichsweise übersichtlich. In den frühen achtziger Jahren zog es Georg Autenrieth nach Berlin, wo er gemeinsam mit dem psychisch labilen Künstler Heinrich Büttner und dem geldbefleckten Müßiggänger Dirk Pruy seine Jugend vergeudete und zum Intellektuellen heranreifte: ein Dandyleben, ausgezeichnet durch eine "hochmütige Melancholie, die mit einer stetigen Angst vor dem Versagen und vor dem Erhaschen eines Blicks auf die Überflüssigkeit und die Unvertretbarkeit der eigenen Existenz einherging". Zwar pflegte Autenrieth Beziehungen zum linksradikalen Milieu, aber im Kern war er ein Zyniker, der allenfalls die akademische Daseinsweise gelten ließ und auch einmal verblasen den "Blitzsieg des Geistes gegen die Kräfte des Nachtkollers" herbeisehnte.
Trotzdem ergaben sich die Freunde mit Haut und Haaren dem Rausch. Wofür hat man denn sonst einen Körper? Außerdem kannten sie ihren Nietzsche gut genug, um zu wissen, dass aus dem Zusammenprall des Dionysischen mit dem Apollinischen die (Lebens-)Kunst hervorgeht.
Der Phallozentrismus habe Berlin zu dieser Zeit fest im Griff gehabt, weiß der Erzähler. Seinem Helden lässt er es in dieser Hinsicht an nichts mangeln. Den zahlreichen Nahaufnahmen aus dem Intimleben gelingt dabei das Kunststück, authentisch, aber nicht anstößig zu wirken. Dass Autenrieth, sexbesessen bis zur Raserei, dem manisch-depressiven Büttner die junge Geliebte Isabel ausspannte, wurde erst in dem Moment zum Problem, als Büttner sich vor einen Zug warf. Die Folge war der komplette Rückzug Autenrieths aus der Öffentlichkeit. Als transparenter "Glasmann" wollte er Buße tun, abwesend unter Anwesenden sein, was sich am Steglitzer Kreisel, einem Ort ohne jede Anschaulichkeit, perfekt verwirklichen ließ.
Dann schließt sich nach dem Modell des doppelten Cursus ein zweiter Umlauf des Helden an, der eine noch ausschweifendere Kopie des ersten zu sein scheint. Wieder gibt es eine tabulose Geliebte, Bilijana mit Namen. Die Bulgarin ist verheiratet mit einem wichtigen Bundesnachrichtendienst-Funktionär und später mausetot. Spätestens jetzt aber sind die Unschärfen von Heisenbergschem Format nicht mehr zu übersehen. Auch zuvor schon hatte Autenrieth geahnt, "dass nicht nur ich es bin, der in meiner Haut steckt", doch nun mehren sich die Hinweise auf eine konkurrierende Biographie. Falkner spielt das Doppelgängermotiv in allen Schattierungen durch, lässt den Leser nicht einmal ganz gewiss sein, ob die drei Freunde wirklich getrennte Personen waren (zumal auch die Figur Dirk Pruy einfach aus der Handlung verschwindet). Von Kellerträumen verfolgt, nagt der Zweifel an Autenrieth: "Der See der Erinnerungslosigkeit, für den das Wort Amnesie nun immer häufiger fiel, wurde immer größer." Hat er eine Tarnidentität gelebt? Steht er viel enger mit der RAF und der Stasi in Verbindung?
Bis in den metaphysischen Existentialismus hinein treibt der Autor das Verwirrspiel, wenn schließlich eine expressionistische Teufelsfigur, die zugleich die Züge eines maliziösen Therapeuten, Kiez-Verrückten und Geheimagenten besitzt, mit der sich selbst unheimlich gewordenen Hauptfigur über deren Integrität als Person spricht. Während das Geschehen im Todesstreifen zwischen Agenten-B-Movie und Depersonalisations-Fallstudie um Fassung ringt, rundet sich das Buch so zum postmodern poetologischen Roman erster Güte, denn natürlich ist es ein Zwiegespräch zwischen Autor und Figur, das wir hier belauschen. Da erschließen sich dann auch die endlos vielen literarischen Bezugnahmen auf Hölderlin, Kleist, Goethe, Balzac, Rilke, Kafka und immer wieder - klar! - Proust, da ergeben die lässig eingestreuten Bemerkungen der Figuren über seinerzeit führende Poststrukturalisten Sinn: Georg Autenrieth ist nicht nur eine Chiffre für Berlin, mit dem er den Wesenskern - die Schizophrenie - teilt, sondern, wenn man so will, Quintessenz und Kulmination der literarischen Tradition selbst, als Konglomerat aus Diskursen autopoietisch in die Welt gekommen und keinem Autor mehr gefügig.
Wenn man es nicht derart hochgedreht will (und das Buch lässt diese Möglichkeit zu), mag man sich die Ichschwäche des Helden vielleicht mit Verdrängung erklären. Wenn die Wahrheit gut dekonstruktiv nur eine "in Sicherheit gebrachte Lüge" ist, kann es auch mehrere nebeneinander geben. In jedem Fall stellt sich beim Leser zunehmend das Gefühl ein, das auch Autenrieth beschlichen haben muss: sich zwischen zwei einander gegenüberstehenden Spiegeln zu befinden. Dass die Kaskaden von Metaphern, Kalauern und Einfällen manchmal gar kein Ende zu nehmen scheinen - auf hohem Niveau ist das Buch durchaus ein wenig verquatscht -, soll kein echter Einwand sein. Man will ja schließlich nicht zu jener Kategorie von Lesern gehören, für die im Roman "meine Vermieterin" herhalten muss, die zeternd den fehlenden Zusammenhang oder die Frauenfeindlichkeit beklagt.
Freuen wir uns lieber, wie verspielt, humorvoll und sprachgewandt der Autor das Berlin der auf dem Boden liegenden Matratzen einfängt. Auf jeder Seite findet sich mindestens ein Satz, der im bonbonbunten Prenzlauer Berg - man hat sich für eine Identität entschieden - auf einen Jutebeutel gedruckt zu werden verdient.
OLIVER JUNGEN
Gerhard Falkner: "Apollokalypse". Roman. Berlin Verlag, Berlin 2016. 430 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"In der Geschichte der Berlin-Literatur beginnt mit diesem Roman ein neues Kapitel.", Süddeutsche Zeitung, Jens Bisky, 03.09.2016