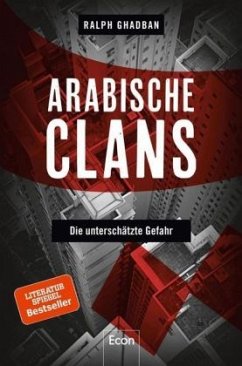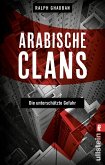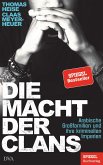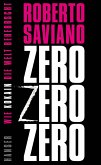Arabische Clans beherrschen die Berliner Unterwelt. Auch in Frankfurt, Bremen und Essen dominieren libanesisch-kurdische Großfamilien die Geschäfte mit Raub, Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Prostitution und Geldwäsche. Mittlerweile sind die kriminellen Clans so stark, dass sie zum Angriff auf die Staatsgewalt übergehen. Sie versuchen, Familienmitglieder bei der Berliner Polizei einzuschleusen, suchen Konfrontation mit Justiz und Jugendämtern und machen Stadtteile zu No-Go-Areas.
Der Migrationsforscher Ralph Ghadban macht das erschreckende Phänomen sichtbar. Er erklärt, woher die Clans kommen und wie sie sich entwickelt haben. Er benennt die Fehler in der Integrationsarbeit und warnt davor, dass neue Einwanderer ebenfalls Clan-Strukturen ausbilden und Banden unsere Städte terrorisieren. Ein kenntnisreiches und Augen öffnendes Buch.
Der Migrationsforscher Ralph Ghadban macht das erschreckende Phänomen sichtbar. Er erklärt, woher die Clans kommen und wie sie sich entwickelt haben. Er benennt die Fehler in der Integrationsarbeit und warnt davor, dass neue Einwanderer ebenfalls Clan-Strukturen ausbilden und Banden unsere Städte terrorisieren. Ein kenntnisreiches und Augen öffnendes Buch.

Der Migrationsforscher Ralph Ghadban fordert ein hartes Durchgreifen gegen arabische Clans
Kurz nach der Wende saß die Berliner Ausländerbeauftragte Barbara John an einem "runden Tisch" zusammen mit fünf Albanern und fünf Vertretern der aus dem Libanon stammenden Volksgruppe der Mhallami. Frau John warb für Recht und Moral, die Männer hörten interessiert zu. Vorausgegangen waren Auseinandersetzungen auf Berliner Straßen zwischen beiden Volksgruppen wegen verweigerter Schutzgelder. Barbara John habe auf die Männer eingeredet, schreibt der Migrationsforscher Ralph Ghadban, der bei dieser "surrealen Szene" damals dabei war, in seinem Buch "Arabische Clans - Die unterschätzte Gefahr". Doch die Teilnehmer, gewaltbereite Schwerkriminelle, hätten kaum Sinn für ihren Vortrag gehabt. Es ging um einen Bandenkrieg. Und für den sind Polizei und Justiz zuständig.
Mit "schönen Worten" zur Integration ist Banden und Clans nicht beizukommen, das schildert Ghadban, der 1972 aus dem Libanon nach Deutschland kam, eindringlich. Sein Buch, 304 Seiten lang, ist kein Werk für den schnellen Überblick. Detailliert erläutert er den Familienbegriff im Islam, erklärt Stammeskultur und Patriarchat und zeichnet die Geschichte der libanesisch-kurdischen Gruppe der Mhallami bis zur Migration nach Deutschland nach. Die historische Einbettung ermöglicht so eine intensive Annäherung an das Phänomen "Clan", das Abschottung als Lebens- und Erfolgsprinzip versteht und in der öffentlichen Wahrnehmung nur auftaucht, wenn Spezialkräfte der Polizei Wohnungen und Shisha-Bars stürmen.
Der promovierte Politologe Ralph Ghadban, ehemaliger Sozialarbeiter und Leiter der Beratungsstelle für Araber des Diakonischen Werks in Berlin, weiß, wovon er schreibt. Leidenschaft für den Kampf des Rechts prägt, wie einst im Buch der Berliner Richterin Kirsten Heisig "Das Ende der Geduld", seine Schilderungen, oft auch unverhohlen Verbitterung. Vor allem wenn es um die parteiübergreifende Ideologie geht, die seiner Meinung nach der Polizeiarbeit immer wieder dazwischengrätscht: Der "Multikulturalismus" begünstige die kriminellen Machenschaften der Clans seit Jahren, zeige sich in laschen Urteilen, mangelnder Strafverfolgung und der Weigerung, das Kind beim Namen zu nennen: Nur Niedersachsen, das einzige Land, das laut Ghadban konsequent gegen Clankriminalität vorgeht, erarbeitet demnach ein polizeiliches Lagebild mit Listen der entsprechenden Großfamilien. In Nordrhein-Westfalen werde erst jetzt, nach dem Regierungswechsel, ein ähnlicher Weg beschritten, Berlin hingegen weigere sich, den Begriff der Clankriminalität zu verwenden, und beharre "auf der alten ideologischen Politik von Multikulti". Aus dem Multikulturalismus, ursprünglich als Abschaffung der Unterschiede und damit der Diskriminierung gedacht, ist somit laut Ghadban inzwischen eine "Politik der Anerkennung der Differenz" geworden. Das Feindbild laute Assimilation: Alle Unterschiede sollen bestehen bleiben - auch diejenigen, die westlichen Werten zuwiderliefen.
Viele dieser "Unterschiede" haben nach Ghadbans Schilderungen die Mhallami Ende der siebziger Jahre mit nach Deutschland gebracht: das Herabschauen auf die "Ungläubigen", woraus die Missachtung von Recht und Gesetz resultiert. Und die Diskriminierung der Frauen, wesentliches Element für Aufbau und Fortbestand der Clans. Durch Zwangsehe und Gewalt in Schach gehalten, sind Frauen für die Geburt möglichst vieler Kinder da, um die Großfamilien immer größer und mächtiger werden zu lassen. Laut Ghadban hat gerade die restriktive Ausländerpolitik in den achtziger Jahren mit Arbeitsverboten und der Abschaffung von Sozialleistungen dazu beigetragen, die Integration der Flüchtlinge zu erschweren. Durch diese "Maßnahmen der Abschreckung", um Wirtschaftsflüchtlinge abzuhalten, hätten sich die Flüchtlinge die Werte der "Gastgesellschaft" kaum aneignen können. "Es war eine verpasste Chance."
Über Jahre bildeten sich so die "Parallelgesellschaften" der Clans, die staatliche Autorität aus "kulturellen und religiösen Gründen" missachten und Deutschland nur als "Beutegesellschaft" wahrnehmen, um sich nicht zuletzt durch Sozialleistungen zu bereichern. "Selbst die vermögenden Kriminellen unter ihnen bleiben Hartz-IV-Empfänger." Bedrohungspotential erhält der Clan der Mhallami, der rund hunderttausend Mitglieder zählt, vor allem durch die Konzentration in Städten wie Berlin, Bremen oder Essen. Immer wieder kommt es zu Konfrontationen, doch Clanmitglieder können binnen Minuten Dutzende Männer mobilisieren, die dann nur mit einem Großaufgebot der Polizei in den Griff zu bekommen sind.
Die Bandbreite der Delikte ist groß: Diebstahl, Erpressung, Prostitution, Drogenhandel, Raubüberfälle. Nach Ghadbans Ausführungen werden nun auch unter den neuen Flüchtlingen verstärkt Handlanger rekrutiert: Während sich die Clans nach seinen Worten immer mehr als "Großhändler" hervortun, würden syrische Flüchtlinge dafür eingesetzt, Drogen in Berlin oder Holland abzuholen. Besonders für die Mhallami sieht Ghadban wenig Hoffnung auf ein (dauerhaft) gesetzestreues Leben. Jugendliche, um die er sich bemüht hatte, landeten früher oder später im Gefängnis: "Von Kindesbeinen an werden die Kinder gedrillt, das Fremde als solches zu betrachten und fremdes Eigentum zu entwenden."
Doch wie werden die "ungeheuren Reichtümer" angelegt, die die Clans anhäufen? Ghadban beschreibt, wie er seinen Klienten früher erklären musste, nicht "voll beladen mit Gold am Hals" zum Sozialamt zu gehen, schließlich sei die Sozialhilfe eine Hilfe in der Not und kein "Gehalt". Inzwischen wird das Geld mit Investitionen in Immobilien, Restaurants, Shisha-Bars, Diskotheken, Bordelle und Drogenhandel gewaschen. Auf diese Weise entstehe ein "krimineller Arbeitsmarkt", der auch "schwachen und untüchtigen" Clanmitgliedern eine Beschäftigung biete.
Um die Clans zu zerschlagen, soll man ihnen nach Ghadbans Einschätzung das wegnehmen, worum es ihnen immer nur geht: das Geld. Als wichtigstes Instrument sieht er die Vermögensabschöpfung. Zusammen mit der konsequenten Durchsetzung der Beweislastumkehr - der Verdächtige muss nun die Herkunft des Geldes nachweisen - wird so die "Gewinnperspektive" der kriminellen Gruppen zerstört, dadurch lockern sich ihre Strukturen. "Die staatliche Aufgabe besteht darin, den Clan zu sprengen, um die Clanmitglieder einzeln zu integrieren." Der Kampf bleibe jedoch wirkungslos, wenn nicht endlich ein "umfassender Informationsaustausch" zwischen Polizei und Sozialämtern etabliert werde. Aus den Fehlern der Vergangenheit müsse angesichts anhaltender Migration gelernt werden: Wenn die Flüchtlinge ähnliche Clanstrukturen aufbauten, gestärkt durch den "erwarteten Familiennachzug", "dann ist der Kampf einfach aus Kapazitätsgründen verloren".
KARIN TRUSCHEIT
Ralph Ghadban: Arabische Clans. Die unterschätzte Gefahr.
Econ Verlag, München 2018. 304 S., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Ghadban ist im Großen und Ganzen ein hervorragendes Buch gelungen, informativ, aufrüttelnd.", Südkurier, Christine Richard, 21.12.2018