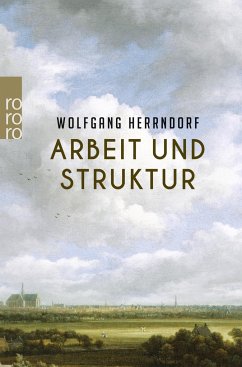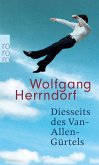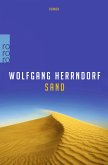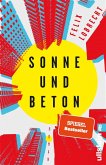«Dann Telefonat mit einem mir unbekannten, älteren Mann in Westdeutschland. Noch am Tag der Histologie war Holm abends auf einer Party mit dem Journalisten T. ins Gespräch gekommen, dessen Vater ebenfalls ein Glioblastom hat und noch immer lebt, zehn Jahre nach der OP. Wenn ich wolle, könne er mir die Nummer besorgen. Es ist vor allem dieses Gespräch mit einem Unbekannten, das mich aufrichtet. Ich erfahre: T. hat als einer der Ersten in Deutschland Temodal bekommen. Und es ist schon dreizehn Jahre her. Seitdem kein Rezidiv. Seine Ärzte rieten nach der OP, sich noch ein schönes Jahr zu machen, vielleicht eine Reise zu unternehmen, irgendwas, was er schon immer habe machen wollen, und mit niemandem zu sprechen. Er fing sofort wieder an zu arbeiten. Informierte alle Leute, dass ihm jetzt die Haare ausgingen, sich sonst aber nichts ändere und alles weiterliefe wie bisher, keine Rücksicht, bitte. Er ist Richter. Und wenn mein Entschluss, was ich machen wollte, nicht schon vorher festgestanden hätte, dann hätte er nach diesem Telefonat festgestanden: Arbeit. Arbeit und Struktur.»

Geht so die Zukunft? Unter den vielen Wegen vom literarischen Blog zum Buch führen manche im Kreis
Wer kennt es nicht, das berühmte Gemälde "Der arme Poet" des berühmten Malers Carl Spitzweg: Der mittellose Dichter bewohnt eine zugige Mansarde, sein Manuskript hat er zum Teil verheizt, doch schon zeigt sich ein neues Werk vor seinem geistigen Auge, das nur er zu erfassen vermag.
So, sollte man denken, entsteht Literatur. In Einsamkeit und Weltferne. Aber das war einmal. Wer zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Dachgeschoss eines urbanen Mehrfamilienhauses dichtet, hat es geschafft, denn diese Wohnungen sind die teuersten von allen. Der arme Poet von heute, der nicht mit Literaturpreisen und Stipendien alimentiert wird, der keine Beachtung im überregionalen Feuilleton erfährt, der vergeblich in Agenturen, Großverlagen und Buchkonzernen antichambriert, lebt in einer fußkalten Erdgeschosswohnung; sein Manuskript hat er zum Teil gelöscht, doch schon zeigt sich ein neues Werk auf dem Display seines veralteten Notebooks, das auch andere zu erfassen vermögen. Denn im Internet kann er Freunde und Fans treffen, die sein work in progress reflektieren, kommentieren und mitgestalten. Er muss nur die Blogfunktion seiner Website aktivieren - so er eine hat. Und irgendwann wird dann aus seinem Literaturblog ein Buch, ein E-Book oder beides gar: So etwa gehen Künstlermärchen von heute.
"Was sind literarische Blogs?" Diese Frage stelle nicht nur ich mir, diese Frage stellt sich auch Aléa Torik, die es eigentlich längst wissen muss. Verdankt doch die Romanautorin und -figur ihre Doppelexistenz dem Blog des Schriftstellers Claus Heck. Als dieser weder Juroren noch Lektoren für seine Prosa einnehmen konnte, generierte er aus seiner Blogadresse den Namen einer jungen rumäniendeutschen Frau, die über Fiktionalität promoviert, ein Literaturblog führt und metafiktionale Romane verfasst, darunter einen über sich selbst. Im wirklichen Leben erhält Hecks Stellvertreterin mit dem Jungschriftstellerin-aus-Osteuropa-Bonus alles, was dem Berliner Autor selbst versagt wurde: Stipendien, Verlagsverträge, einen Eintrag im Munzinger-Archiv, Wahrnehmung und Lob in der Presse sowie die Aufmerksamkeit mehrerer Promotionskandidaten.
Nicht die Sprache oder die Welthaltigkeit dieser Literatur, sondern die Konstruktion multipler Fiktionsebenen und Scheinidentitäten lässt mich an Jorge Luis Borges denken, an Mircea Cartarescu, Raymond Federman, Italo Calvino. Autoren, denen Claus Heck nacheifert und über die er Aléa Torik bloggen lässt. Gleichwohl ist ihre Webpräsenz nicht einer jener zahlreichen Rezensionsblogs, in denen lesernahe, von den Verlagen mehr und mehr umworbene Hobbykritiker Romane, Erzählungen und Gedichte hochloben, sondern ein vielfach verlinkter, fortlaufend von anderen kommentierter Mix primär- und sekundärliterarischer Texte aus semifiktiver Ich-Perspektive. In ihrem Post über "Literatur 2.0" stellt sich Aléa Torik zwei weitere Fragen, die auch mich umtreiben, nämlich: wo literarische Blogs zu finden sind und - nicht zuletzt - wie gelungen sie sind.
Ich gebe diese Fragen weiter an Hartmut Abendschein, der es eigentlich wissen muss. Er ist in Personalunion Autor, Verleger und - neben der Kulturwissenschaftlerin Christiane Zintzen - Herausgeber des Blogportals www.litblogs.net. In Kooperation mit der Universität Innsbruck und dem Marbacher Literaturarchiv werden poetische Weblogs deutscher Sprache präsentiert und für die Nachwelt archiviert. Man wolle die Bandbreite literarischen Schreibens in Blogform vermitteln, erklärt mir Abendschein am Telefon, die vielen unterschiedlichen Ansätze, für die er mir gern ein paar Beispiele nennen werde. Der Blogger sei, wie übrigens auch der Selfpublisher, in Personalunion Autor, Verleger und Herausgeber, bringe aber kein abgeschlossenes Werk heraus, sondern nehme die Vermittler seiner Literatur mit ins Boot. Und das sei zukunftsweisend, frohlockt Abendschein fernmündlich.
In seinem kleinen Hybridverlag edition taberna kritika erscheinen unter anderem Texte als Bücher und/oder E-Books, die in Literaturblogs entstanden sind. Zu den Autorinnen und Autoren gehören der Verleger selbst, seine Ko-Herausgeberin Christiane Zintzen, der Berliner Schriftsteller Alban Nikolai Herbst, der Thuner Künstler Anton Rittiner, der in Umbrien lebende Lyriker und Übersetzer Helmut Schulze. Ich finde in ihren Blogs Mikrostories, Gedichte, Romanauszüge, Rezensionen, Collagen in Wort, Bild und Ton, poetologisches, autobiographisches und dokumentarisches Material, Notizen, Briefe, E-Mails, Threads, Tagebücher, Verweise auf andere und anderes, zahlreiche Links sowie die Kommentare anderer und Auszüge aus deren Blogs, die ebenfalls Mikrostories Gedichte, Romanauszüge und so weiter enthalten. All dies ist in Teilen interessant, amüsant und inspirierend, in Teilen anstrengend, unerheblich und ermüdend.
Aber Blogger gelten nicht als talentlose Schwadroneure, für die sich kein ernstzunehmender Verlag interessiert. Im Gegenteil: Ernstzunehmende Verlage ahmen Blogger nach. Suhrkamp, Fischer, Ullstein stellen ihren Autoren hauseigene Literaturblogs zur Verfügung. Klein- und Kleinstverlage postpublizieren Blogposts und deren literarische Folgen, wie etwa die Flaneurtexte "Monogold", die René Hamann zunächst in seinem Blog "Die Suche nach dem Glam" gepostet hat. Oder Norbert W. Schlinkerts Roman "Stadt, Angst, Schweigen", der wie das Literaturblog des Autors, "Nachrichten aus den Prenzlauer Bergen", in dem Berliner Stadtteil mit der höchsten deutschen Dichterdichte verortet ist.
Rhizomatisch wuchern Literaturblogs nicht nur inner-, sondern auch außerhalb des Internets. Beispielsweise ist http://rheinsein.de/ des Kölner Lyrikers und Spoken-Word-Performers Stan Lafleur mehr als eine kulturgeschichtliche Digitalenzyklopädie des Rheinlands, denn "aus dem rheinsein-Datenpool entstehen zeitgleich wiederum klassische literarische Derivate wie Bücher, Hörspiele, Lesungen, Vorträge, (Hochschul-)Seminare etc." Beispielsweise stellt der Leipziger Schriftsteller Jan Kuhlbrodt auf http://postkultur.wordpress.com/ poetologische Betrachtungen über Texte aus handfesten Büchern an. Beispielsweise hat das gebloggte Journal "Arbeit und Struktur" des frühverstorbenen Berliner Autors Wolfgang Herrndorf auch als Buch und E-Book ein breites Publikum erreicht. Und doch, vertraut mir Weblog-Experte Hartmut Abendschein am Telefon an, sind Weblog-Experten davon überzeugt, dass die Zukunft der Literatur nicht dem Buch oder dem E-Book gehört, sondern dem Internet. Wenn Sie darüber mehr erfahren möchten, dann lesen Sie hier demnächst weiter.
ELKE HEINEMANN.
Elke Heinemann lebt als Schriftstellerin und Publizistin in Berlin. Ihr multimediales E-Book "Nichts ist, wie es ist. Kriminalrondo" wurde soeben als eines von drei fiktionalen Werken für den Deutschen E-Book Award 2015 nominiert. Die letzte Folge ihrer monatlichen E-Lektüren erschien am 3. September.
Aléa Torik: "Aléas Ich". Roman.
Kindle Edition. Osburg Verlag, Berlin 2013.
www.aleatorik.eu/.
www.litblogs.net/.
www.etkbooks.com/.
www.logbuch-suhrkamp.de/.
www.hundertvierzehn.de/ http://resonanzboden.com/.
René Hamann: "Monogold". Texte aus dem Blog "Die Suche nach dem Glam". SuKuLTuR Verlag, Berlin 2013 (vergriffen).
http://renehamann.blogspot.de/.
Norbert W. Schlinkert: "Stadt, Angst, Schweigen". Roman. Elsinor Verlag, Coesfeld 2015. 140 S., br., 12,80[Euro].
nwschlinkert.de//category/nachrichten/.
http://rheinsein.de/.
www.postkultur.wordpress.com.
Wolfgang Herrndorf: "Arbeit und Struktur".
Kindle Edition. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2013. www.wolfgang-herrndorf.de/
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Bei aller Hochschätzung für Herrndorfs Romane - sein Blog Arbeit und Struktur steht ihnen an literarischem Rang nicht nach. Es gibt in der Geschichte der Tagebücher nichts, was ihm gleichkäme an Takt, Wärme, dunklem Witz, Sarkasmus und stillem Grauen. Michael Maar
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Überflüssige Zeugnisse verlängerter Adoleszenz findet Joachim Güntner in diesem letzten Buch von Wolfgang Herrndorf ebenso wie Glanzlichter eines Kampfes, den der Autor nur verlieren konnte. Oder nicht? Große Literatur ist das für Güntner jedenfalls nicht, eher die Mühle der Selbstbeobachtung, verzweifelt Exaltiertes inbegriffen. Als das eigentliche Testament des Autors erkennt Güntner denn auch etwas anderes: Den möglichen Anstoß einer Debatte über den freien Zugang zu Suizid-Mitteln nämlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH