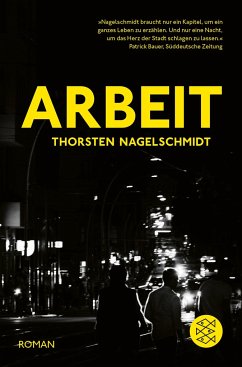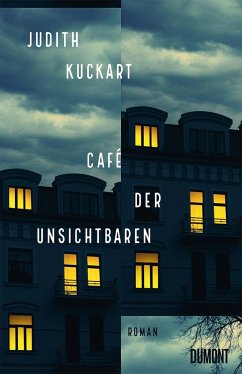Nicht lieferbar
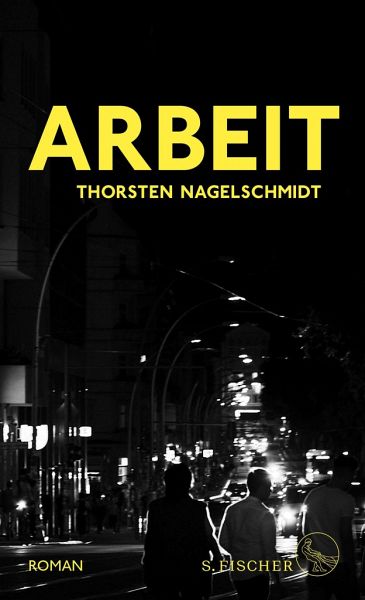
Arbeit
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
In einem Kreuzberger Hostel beginnt Sheriff seine Nachtschicht und fühlt sich mal wieder wie ein schlecht bezahlter Sozialarbeiter. Im Späti nebenan erlebt Anna den zweiten Überfall in diesem Jahr. An der Tür vom Lobotomy steht Ten und realisiert, dass ihm seine junge Familie durch seine Arbeitszeiten komplett zu entgleiten droht. Außerdem: Eine idealistische Notfallsanitäterin, eine zornige Pfandsammlerin und ein Drogendealer mit Zahnschmerzen, der sich fragt, ob er Freunde hat oder nur noch Stammkunden.Thorsten Nagelschmidt hat mit »Arbeit« einen großen Gesellschaftsroman über all ...
In einem Kreuzberger Hostel beginnt Sheriff seine Nachtschicht und fühlt sich mal wieder wie ein schlecht bezahlter Sozialarbeiter. Im Späti nebenan erlebt Anna den zweiten Überfall in diesem Jahr. An der Tür vom Lobotomy steht Ten und realisiert, dass ihm seine junge Familie durch seine Arbeitszeiten komplett zu entgleiten droht. Außerdem: Eine idealistische Notfallsanitäterin, eine zornige Pfandsammlerin und ein Drogendealer mit Zahnschmerzen, der sich fragt, ob er Freunde hat oder nur noch Stammkunden.
Thorsten Nagelschmidt hat mit »Arbeit« einen großen Gesellschaftsroman über all jene geschrieben, die nachts wach sind und ihren Job erledigen, während Studenten, Touristen und Raver feiern. Temporeich erzählt er von zwölf Stunden am Rande des Berliner Ausgehbetriebs und stellt Fragen, die man beim dritten Bier gerne vergisst: Auf wessen Kosten verändert sich eine Stadt, die immer jung sein soll? Für wen bedeutet das noch Freiheit, und wer macht hier später eigentlich denganzen Dreck weg?
Thorsten Nagelschmidt hat mit »Arbeit« einen großen Gesellschaftsroman über all jene geschrieben, die nachts wach sind und ihren Job erledigen, während Studenten, Touristen und Raver feiern. Temporeich erzählt er von zwölf Stunden am Rande des Berliner Ausgehbetriebs und stellt Fragen, die man beim dritten Bier gerne vergisst: Auf wessen Kosten verändert sich eine Stadt, die immer jung sein soll? Für wen bedeutet das noch Freiheit, und wer macht hier später eigentlich denganzen Dreck weg?