Nicht lieferbar
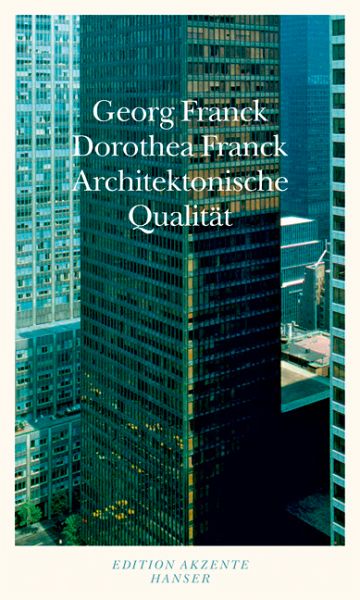
Architektonische Qualität
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Dieses Buch führt neue Maßstäbe in die architektonische Debatte ein: Was macht die Qualität von Architektur aus? Eine altmodische Frage angesichts des Kults, der um die schrillen Stars der globalen Architektenszene getrieben wird. Gebaut aber wird nicht für eine Saison, schlechte Architektur bleibt für Jahrzehnte ein Ärgernis. Für Georg und Dorothea Franck gibt es Kriterien, nach denen die Qualität eines Bauwerks beurteilt werden kann: sein Verhältnis zur Umgebung, seine Funktionalität, seine sinnliche Ausstrahlung. Es ist keine Sache der Beliebigkeit, welche Entwürfe diesen Anforderungen entsprechen. Die Kenntnis der kanonischen Vorbilder spielt dabei mindestens die gleiche Rolle wie ein wacher Sinn für die Spielregeln der modernen Gesellschaft.




