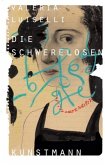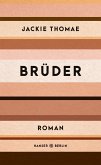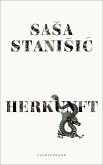Eine Familie aus New York bricht zu einer Reise auf. Das Ziel ist Apacheria, das Land, in dem einst die Apachen zu Hause waren. Gleichzeitig sind Tausende von Kindern aus Südamerika auf dem Weg in den Norden. Meisterhaft verknüpft Archiv der verlorenen Kinder Reise und Flucht zu einem vielschichtigen Roman voller Echos und Reflektionen.Eine Mutter, ein Vater, ein Junge und ein Mädchen packen in New York ihre Sachen ins Auto und machen sich auf in die Gegend, die einst die Heimat der Apachen war. Sie fahren durch Wüsten und Berge, machen Halt an einem Diner, wenn sie Hunger haben, und übernachten, wenn es dunkel wird, in einem Motel. Das kleine Mädchen erzählt Witze und bringt alle zum Lachen, der Junge korrigiert jeden, der etwas Falsches sagt. Vater und Mutter sprechen kaum miteinander.Zur gleichen Zeit machen sich Tausende von Kindern aus Zentralamerika und Mexiko nach Norden auf, zu ihren Eltern, die schon in den USA leben. Jedes hat einen Rucksack dabei mit einem Spielzeug und sauberer Unterwäsche. Die Kinder reisen mit einem Coyote: einem Mann, der ihnen Angst macht. Sie haben einen langen Marsch vor sich, für den sie sich Essen und Trinken einteilen müssen. Sie klettern auf Züge und in offene Frachtcontainer. Nicht alle kommen bis zur Grenze.Mit literarischer Virtuosität verknüpft Valeria Luiselli Reise und Flucht zu einem vielschichtigen Roman voller Echos und Reflektionen, zu einer bewegenden und brandaktuellen Geschichte darüber, was Flucht und was Menschlichkeit bedeuten in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Rezensentin Eva-Christina Meier versteht, warum "Archiv der verlorenen Kinder" für den Booker Prize nominiert wurde: Die Geschichte über den Roadtrip einer Patchwork-Familie - mexikanische Radiojournalistin, ihr amerikanischer Mann und die beiden Kinder - in den Süden der USA hat sie tief berührt. Die Reporterin will in Texas über geflüchtete Kinder aus Mittelamerika recherchieren, nacheinander schildern sie und ihr Sohn, wie sie die Reise wahrnehmen, erzählt die Kritikerin. Den Jungen beeindrucken die Gedanken seiner Stiefmutter zu den Schicksalen der Flüchtlingskinder nachhaltig und so entsteht laut Meier ein feinsinniger und düsterer Roman über aktuelle drängende Fragen, den die Rezensentin nur stellenweise ein wenig überambitioniert fand.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Valeria Luiselli begibt sich in "Archiv der verlorenen Kinder" ins Grenzgebiet zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko
Kinder hinter Gittern, in Wärmedecken auf dem Boden kauernd, in militärisch streng geordneten Reihen auf einem Hof. Niemand kann heute über die Flüchtlingskinder sprechen, die allein, ohne ihre Eltern, entlang der Südgrenze der Vereinigten Staaten in Auffanglagern untergebracht sind, ohne an diese Bilder zu denken. Über die offenbar menschenunwürdigen Zustände in diesen Lagern wird zu recht heftig diskutiert. Zugleich legt eine längst etablierte Medienwelt routiniert unsere Mitleidserregungen fest: eilig gedrehte Filmschnipsel, unscharfe Schnappschüsse lassen die Erregungswelle hochschlagen, worauf die vorhersehbare Abkühlung und schließlich das selbstberuhigende Vergessen folgen.
Wer diskutiert heute noch die katastrophale Situation im Jahr 2015? Als in Ländern wie Guatemala und El Salvador die Bandenkriminalität über ihr eh schon unerträgliches Maß hinaus eskalierte. In den Vereinigten Staaten regierte Präsident Obama. Und die Öffentlichkeit debattierte erhitzt über Tausende Kinder, die von Schleppern geführt entweder in der Wüste verdursteten oder interniert wurden, um sie im Normalfall - nicht etwa im Ausnahmefall - in ihre Herkunftsländer abzuschieben.
Wer sich fünf Jahre später noch zuständig für das Schicksal der Flüchtlingskinder fühlt, kann nicht mehr einfach nur auf einen Auslöser drücken und auf den Schockeffekt menschlicher Schaulust setzen, sondern muss anfangen zu erzählen. Wie aber soll eine Erzählung vom Leiden aussehen? Was wäre auf diese Weise sichtbar zu machen, das von den anderen Darstellungsformen nicht ins Bild gerückt werden kann? Soll man überhaupt über diese Ereignisse schreiben? Macht man das tatsächliche Leid der Kinder dadurch nicht nur noch einmal zum Spektakel, damit die privilegierten Zuschauer sich mit einem gut dosierten Gänsehautmoment in ihre Lesekissen kuscheln können? Also besser schweigen? Anders gefragt: Hat die Literatur dort, wo das Leiden der Welt gegenwärtig zu Hause ist, nichts zu suchen?
Valeria Luiselli, in Mexiko geboren, als Tochter eines Diplomaten unter anderem in Südkorea aufgewachsen, hat sich dieser Fragen in zweifacher Weise angenommen. Zuerst in ihrem fulminanten Essay "Tell Me How It Ends", der 2017 in den Vereinigten Staaten erschienen ist, bislang aber nicht auf Deutsch veröffentlicht wurde. Und in ihrem Roman "Das Archiv der verlorenen Kinder". Die beiden Bücher sind die ersten, die Luiselli auf Englisch publiziert hat. In jener Sprache, die sie von ihrem fünften Lebensjahr an erlernt hat. Auch ihre Zuwendung zur Sprache des potentiellen Ankunftslandes, in dem 60 Millionen spanischsprachige Einwohner leben, schließt im Zuge der Einwanderungsfrage eine klare Positionierung ein.
Luisellis Roman besticht durch seine kluge Lösung dafür, wie man angemessen vom Leiden anderer erzählen kann. Er besteht aus einer Komposition verschiedenster Materialien und Erzählschichten und lässt die Geschichte in einer Stimmenvielfalt aufgehen. Abwechselnd kommt dieser oder jener Strang an der Textoberfläche zum Tragen. Und das Zusammenspiel erzeugt eine atemberaubend dichte Erzählung.
Das "Archiv der verlorenen Kinder" erzählt zuerst von einem Roadtrip. Die Erzählerin macht sich gemeinsam mit ihrem Mann, dessen zehnjährigem Sohn und ihrer eigenen fünfjährigen Tochter von New York City aus auf eine Reise in den Südosten Arizonas: Chiricahua-, Indianer-Land. Die Mutter will auf dem Weg dorthin über die beiden Töchter einer New Yorker Bekannten recherchieren. Deren Schicksal: von einem Schlepper an die Grenze gebracht, im Auffanglager gestrandet und jetzt von dort in die Wüste geflohen. Auch wenn sie die Kinder selbst nicht finden mag, so will die Erzählerin zumindest eine Tondokumentation über das Schicksal dieser verlorenen Kinder erstellen. Ihr Mann hingegen hat ein Arbeitsprojekt über die Indianerstämme der Apacheria im Sinn. Akribisch hat er sich in die Kultur der Chiricahua und ihres letzten Häuptlings Geronimo eingearbeitet. Vier Archivschachteln, gefüllt mit seinen Materialien, nimmt er mit. Eine solche Box hat auch die Erzählerin sich angelegt, voller Zeitungsartikel, Bücher, Karten, Notizen und Exzerpte. Die beiden Kinder fordern ebenfalls jeweils eine Box ein; anfangs sind sie leer. Im Laufe der Zeit füllen sie sich mit Fundstücken.
Der Sohn zum Beispiel lernt auf der Reise, mit seiner Polaroid-Kamera umzugehen. Mit diesen Bildern füllt sich seine Box. Aus seinem Fundus steuert er zwei lange Passagen des Romans bei. Denn Luiselli öffnet diese Schachteln nun nacheinander und lässt ihre Materialien für sich sprechen. Gleichzeitig balanciert die Themen- und Stimmenvielfalt die Flüchtlingsdramatik geschickt aus. Auch deshalb, weil diese Reise in das dunkle Herz einer unausweichlichen Trennung führt. Das Paar hat sich auseinandergelebt. Von vornherein steht fest: Vater und Sohn werden im Süden bleiben, während Mutter und Tochter nach New York zurückreisen. Die Kinder wissen noch nichts, ahnen aber alles.
So ungreifbar fern das Reiseziel zunächst sein mag. Die Vier im Auto sind einem sehr schnell extrem nah. Der schweigsame Vater, der sich schlagartig als passionierter Erzähler entpuppt, wenn es um die Indianer-Kultur geht. Die nicht weniger eigenwillige Mutter, die beim Gedanken an die verlorenen Kinder vor Empörung und Leidenschaft kaum zu halten ist. Der verletzlich wirkende, intellektuell wache Junge. Und das fünfjährige Mädchen, deren phantasiewirbelnde Gedankenwelten kein Weißgesicht mit einem Lasso einfangen könnte. Schon nach wenigen Seiten wartet man mit im Auto sitzend auf den Cormac-McCarthy-Satz "Wenn er im Dunkel und in der Kälte der Nacht erwachte", der auf geheimnisvolle Weise immer zuerst erklingt, wenn die Mutter ihr Smartphone an die Anlage anschließt. Man lässt auf Kinderwunsch David Bowies "Major Tom" in Dauerschleife ins Weltall entschwinden. Oder staunt über die avantgardistische Qualität jedes "Klopfklopf"-Witzes, den das Mädchen erfindet. Es muss in diesem Erzählstrom gar nicht viel passieren, und es geschieht auch nichts weiter, als dass man den Kindern und ihren Eltern zuhört, bei ihren Geschichten, Spielen, Kämpfen, Langeweile-Anfällen und vergnügten Lachepisoden.
Die Weite der amerikanischen Landschaft fügt sich perfekt zu Luisellis atmosphärischem, ruhig dahintreibendem Erzählstil, der sich zu höchster Dringlichkeit und dunklen Wolken verdichten kann. Etwa wenn es der Mutter beim Blick in die so beeindruckende Weite dieser Landschaft einfach nur absurd vorkommt, wie man flüchtenden Kindern gegenüber behaupten kann, "in diesem gigantischen leeren Land" sei "kein Platz für sie".
Dieser Familien-Roadtrip ist eine großartige Erzählung, macht allein aber noch keinen Luiselli-Roman. Dazu wird das "Archiv der verlorenen Kinder" erst, als Luisellis Erzählerin nach einiger Zeit beginnt, ein Buch von Ella Camposanto zu lesen. In sechzehn Elegien wird dort das Schicksal von zwei Mädchen auf ihrer Flucht zur Grenze erzählt. Die Mädchen haben frappierende Ähnlichkeit mit denen in New York City so sehnlich erwarteten. Ella Camposanto kann so eindringlich erzählen, als wäre sie Luiselli. Und das ist sie auch. Denn Luiselli hat sie erfunden. Mit dem Einsetzen der Elegien führen die Reiseroute der Familie und der Fluchtweg der Mädchen direkt aufeinander zu. Gekonnt spitzt der Roman die Phantasie eines möglichen Aufeinandertreffens weiter zu. Denn eines Tages fasst der Junge auf der Rückbank des Autos den Entschluss, gemeinsam mit seiner Schwester auszureißen. Was bislang Recherche war, wird plötzlich in jeder Körperfaser gespürter Ernst.
Luisellis "Archiv der verlorenen Kinder" ist nicht nur ein Flüchtlingsroman. Es verhandelt zugleich drängende Fragen dokumentarischer Ästhetik, eröffnet eine hochgradig spannungsreiche Kulturgeschichte des Grenzgebiets zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko, spürt dem im Unglück geglückten Familienleben nach und zeigt, dass wir zu gerne aus den Augen verlieren, was die Moderne doch erst erfunden hat: die Würde des einzelnen Kindes - das beschützt, statt der Welt ausgesetzt werden soll.
CHRISTIAN METZ
Valeria Luiselli: "Archiv der verlorenen Kinder". Roman. Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit, Verlag Antje Kunstmann, 432 Seiten, 25 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main