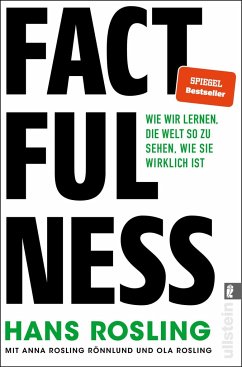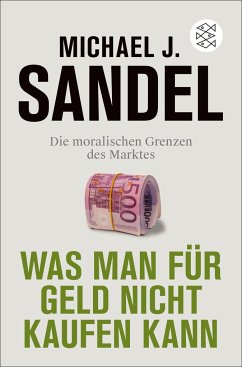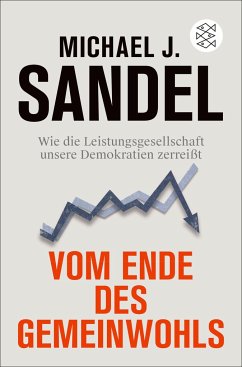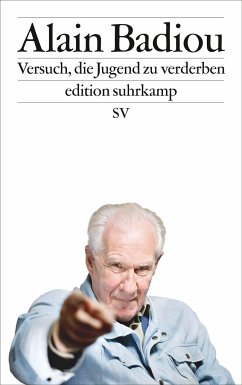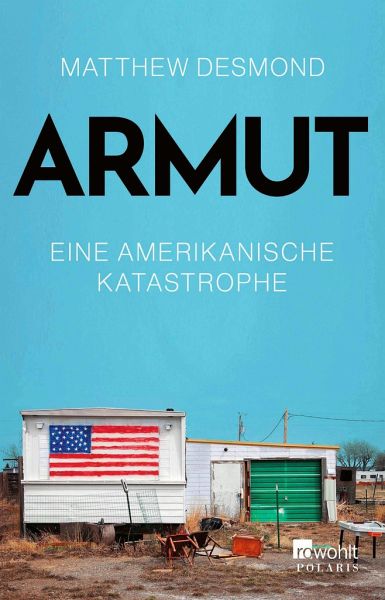
Armut
Eine amerikanische Katastrophe Die schonungslose Analyse eines menschengemachten Problems
Übersetzung: Neubauer, Jürgen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die USA sind das reichste Land der Welt - und doch gibt es hier mehr Armut als in jeder anderen fortgeschrittenen Demokratie: Würden die Betroffenen einen eigenen Staat gründen, hätte dieser eine größere Bevölkerung als Australien oder Venezuela. Warum klaffen gerade hier, wo doch alle Mittel vorhanden sein sollten, Reich und Arm, Anspruch und Realität so drastisch auseinander?Der Soziologe und Pulitzer-Preisträger Matthew Desmond zeigt eine bittere Wahrheit, die weit über die USA hinausweist und ins Innerste der kapitalistischen Gesellschaften zielt: Dass Millionen von Menschen in Ar...
Die USA sind das reichste Land der Welt - und doch gibt es hier mehr Armut als in jeder anderen fortgeschrittenen Demokratie: Würden die Betroffenen einen eigenen Staat gründen, hätte dieser eine größere Bevölkerung als Australien oder Venezuela. Warum klaffen gerade hier, wo doch alle Mittel vorhanden sein sollten, Reich und Arm, Anspruch und Realität so drastisch auseinander?
Der Soziologe und Pulitzer-Preisträger Matthew Desmond zeigt eine bittere Wahrheit, die weit über die USA hinausweist und ins Innerste der kapitalistischen Gesellschaften zielt: Dass Millionen von Menschen in Armut leben, ist nicht etwa eine strukturelle Zwangsläufigkeit oder das Ergebnis je individuellen Fehlverhaltens - Armut existiert und besteht fort, weil es Menschen gibt, die davon profitieren. Doch nicht nur Konzerne und Kapitalgesellschaften, sämtliche Wohlhabenden tragen, wissend oder unwissend, zur Aufrechterhaltung der Missstände bei. Was politische Mythen, Profitinteressen, aber auchtägliche Konsumentscheidungen damit zu tun haben - das wurde selten so schonungslos aufgezeigt. Eine wütende Anklage und ein entschiedenes Plädoyer: Die Armut, dieses himmelschreiende Unrecht, muss nichts weniger als endlich abgeschafft werden.
Der Soziologe und Pulitzer-Preisträger Matthew Desmond zeigt eine bittere Wahrheit, die weit über die USA hinausweist und ins Innerste der kapitalistischen Gesellschaften zielt: Dass Millionen von Menschen in Armut leben, ist nicht etwa eine strukturelle Zwangsläufigkeit oder das Ergebnis je individuellen Fehlverhaltens - Armut existiert und besteht fort, weil es Menschen gibt, die davon profitieren. Doch nicht nur Konzerne und Kapitalgesellschaften, sämtliche Wohlhabenden tragen, wissend oder unwissend, zur Aufrechterhaltung der Missstände bei. Was politische Mythen, Profitinteressen, aber auchtägliche Konsumentscheidungen damit zu tun haben - das wurde selten so schonungslos aufgezeigt. Eine wütende Anklage und ein entschiedenes Plädoyer: Die Armut, dieses himmelschreiende Unrecht, muss nichts weniger als endlich abgeschafft werden.