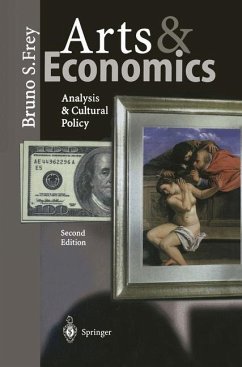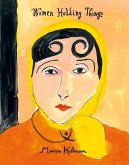Using the economic perspective, this exciting text offers an alternative view to sociological or art historic approaches to art. The issues discussed include: institutions from festivals to "superstar" museums, different means of supporting the arts, an investigation into art as an investment, and the various approaches applied when valuing our cultural properties. This text challenges widely held popular views and, once started, is difficult to put down.
To put the ARTS & ECONOMICS next to each other, as in the title to this book, may be shocking to some readers. Must not creative art be free of economic constraints, must it not lead a life of its own? And is economics not the realm of mean commercial dealings? This book argues that it is not so: the ARTS & ECONOMICS go well together, indeed need each other. Without a sound economic base, art cannot exist, and without creativity the economy cannot flourish. There is a second way in which the Arts and Economics go together, namely in the sense of applying economic thinking to the arts. Over the last decades, this scholarly endeavor has been established under the name of "The Economics of Art" or "Cultural Economics". But this may also sound revolting to some readers as it suggests an imperialistic extension of a lowly benefit-cost calculus to the world of art. This fear is unwarranted. On the contrary, cultural economists stress the social value of art and defend it against a crude business view of art. Rather than dismissing art without direct commercial profit, art economists seek ways and means of supporting it. This book is not a textbook summarizing the achievements attained by the economics of art. Such books already exist, among them the author's own, Muses and Markets, Explorations in the Economics of Art, written jointly with Werner Pommerehne. VI Preface ARTS & ECONOMICS charters little known territories.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
To put the ARTS & ECONOMICS next to each other, as in the title to this book, may be shocking to some readers. Must not creative art be free of economic constraints, must it not lead a life of its own? And is economics not the realm of mean commercial dealings? This book argues that it is not so: the ARTS & ECONOMICS go well together, indeed need each other. Without a sound economic base, art cannot exist, and without creativity the economy cannot flourish. There is a second way in which the Arts and Economics go together, namely in the sense of applying economic thinking to the arts. Over the last decades, this scholarly endeavor has been established under the name of "The Economics of Art" or "Cultural Economics". But this may also sound revolting to some readers as it suggests an imperialistic extension of a lowly benefit-cost calculus to the world of art. This fear is unwarranted. On the contrary, cultural economists stress the social value of art and defend it against a crude business view of art. Rather than dismissing art without direct commercial profit, art economists seek ways and means of supporting it. This book is not a textbook summarizing the achievements attained by the economics of art. Such books already exist, among them the author's own, Muses and Markets, Explorations in the Economics of Art, written jointly with Werner Pommerehne. VI Preface ARTS & ECONOMICS charters little known territories.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Zu den gern wiederholten Behauptungen über den Kunstmarkt gehört, er werfe beträchtliche Renditen ab. Wer sich in Kenntnis des Markts setze, dem böten sich erhebliche Gewinnchancen. Eine ganze Literatur an Beratungsbüchlein und ein ganzes Meldungswesen, was Rekordsummen bei Auktionen betrifft, sorgen für die Stabilität dieser Vermutung. Sie ist das "und wenn sie nicht gestorben sind" aller Kunstmarktgeschichten.
Was ein Markt diesseits solcher Geschichten tatsächlich ist, das zu sagen fällt allerdings selbst Ökonomen nicht leicht. Man kauft beim Galeristen, aber nicht "auf dem Markt für Skulpturen". Doch selbst wenn man sich alle Verkaufsorte und Firmen vorstellt, die eine bestimmte Warensorte anbieten, hat man aus ökonomischer Sicht noch keinen Markt beisammen. Denn auch die Einkaufspläne der Nachfrager, auch die im Augenblick nicht angebotenen Waren, auch die "nahen Substitute" - bei Skulpturen etwa andere Gartenmöbel - bestimmen nach Ansicht der Ökonomen irgendwie, was "auf dem Markt" geschieht. Manche Ökonomen nehmen es mit ihrem Marktbegriff so genau, daß sie sogar bezweifeln, ob auf einem Markt überhaupt "tangible" Gegenstände gehandelt werden. Ist der Kunstmarkt, so würden sie fragen, überhaupt ein Markt, auf dem es um Objekte geht? Es könnte ja sein, daß das, wofür dort Preise verlangt und bezahlt werden, bloß bestimmte Eigenschaften der jeweiligen Dinge sind, Eigenschaften, die sie mit ganz anderen, kunstfernen Dingen teilen. Bilder und Skulpturen lassen sich ja nicht nur anschauend genießen: Man kann mit ihnen angeben, zeigen, was einem die Vergangenheit bedeutet, oder andeuten, daß man ziemlich modern lebt. Muß also, wer den Kunstmarkt verstehen will, nicht auch den Markt für Luxuslimousinen, Zweitboote, und Polopferde im Blick haben? Wer Kunsthändlern zuhört oder Auktionshäusern, stößt auf zahlreiche Sätze, die diesen Eindruck stützen. Der Markt, so scheint es, ist also vor allem eins - das Gerede der Interessenten über ihre Geschäfte. Niemand kann genau sagen, was alles zu ihm gehört und wo seine Grenzen verlaufen; je nach Stimmung und Kundschaft verändert sich seine Größe und die Auskunft, worum es hier eigentlich geht.
In einem lesenswerten Überblick über die wirtschaftswissenschaftliche Literatur zum Kunsthandel weist der Schweizer Ökonom Bruno S. Frey darauf hin, daß es eine Grenze für solche Erzählungen über den Kunstmarkt gibt: die Empirie des Kunstmarkts. Das betrifft vor allem die Mär von den sagenhaften Wertzuwächsen. Seit den siebziger Jahren sind nämlich eine Reihe von Studien über die Durchschnittsrenditen angestellt worden, die auf dem Markt für verschiedene Kunstobjekte langfristig zu erzielen waren. Die Resultate sind für die Freunde des Marktmärchens enttäuschend. Zwischen 1652 und 1961 etwa läßt sich aufgrund von Auktionsergebnissen zeigen, daß Bilder eine reale Verzinsung von 0,55 Prozent boten, was selbst von britischen Staatsschuldpapieren deutlich übertroffen wurde. Auch in der Nachkriegszeit war zwischen 1950 und 1987 der Zugewinn von 1,6 Prozent nicht wirklich großartig. Wer zwischen 1803 und 1987 meinte, durch Ankauf einer Stradivari sein Vermögen mehren zu können, dem gelang es im Durchschnitt mit 2,2 Prozent. Wer Hoffnungen in den Markt für alte Feuerwaffen setzte, legte in den letzten Jahrzehnten sogar drauf.
Daß sich angesichts solcher Umstände jenes "und wenn sie nicht gestorben sind, dann profitieren sie noch heute" halten kann, hängt vielleicht an einer spezifischen Sehstörung mancher Beobachter des Kunstmarkts. So hat Christie's 1997 die Kollektion von Victor und Sally Ganz versteigert. Damals wurden 207 Millionen Dollar erzielt, für eine einzige Sammlung eine Rekordsumme. Ein Picasso, der 1941 7000 Dollar kostete, ging für 48,4 Millionen weg, ein Jasper Johns, der 1964 für 15 000 Dollar gekauft wurde, erbrachte 7,9 Millionen. Das Staunen über solche Wertzuwächse beruht aber nicht auf Kalkulation, sondern auf dem Wunsch, daß hier der Glaube an bedeutende Kunst honoriert wird. Es dürfte sich durch den Hinweis mäßigen, daß auch 7000 Dollar, die 1941 in eine amerikanische Aktie gesteckt worden sind, sich 1997 im Durchschnitt zu 47,8 Millionen Dollar verzinst haben. Zieht man vom Picasso fällige Auktionskommissionen und -gebühren ab, dann stehen Aktien noch besser da.
Aus Befunden wie diesen schließt Frey, daß der Kunstmarkt durch eine Reihe von Verhaltensabweichungen der an ihm Beteiligten gekennzeichnet ist. So würde wohl niemand, anstatt ein Bild für eine Million Mark zu erwerben, es alternativ im Jahr für 50 000 oder im Monat 4000 Mark mieten - obwohl das bei einem Zinssatz von fünf Prozent im Jahr ökonomisch auf dieselbe Ausgabe hinausliefe. Berechnendes Verhalten liegt auch dann nicht vor, wenn private Museen Bilder nicht verkaufen, obwohl sie sie niemals zeigen. Reine Sammler bestimmen gegenüber reinen Vermögensanlegern große Bereiche des Kunsthandels und kaufen ohne Rücksicht darauf, ob sie auch wieder profitabel verkaufen können. Sie verlassen den Markt nicht gleich bei jedem Stimmungsumschwung, sondern üben sich in ästhetischem Gleichmut gegenüber seinen Risiken. Schließlich ziehen sie Kunstgegenstände als Besitz gegenüber weniger persönlichen Vermögensanlagen vor. Wer möchte seinen Nachfahren schon als Besitzer von Kommunalobligationen im Gedächtnis bleiben? Das Polopferd oder das Zweitboot eignen sich hier schon besser - zur Mitteilung von Individualität aber auch selbst dann nicht, wenn sie "Picasso" heißen. Kunstwerke und alte Feuerwaffen hingegen erlauben alle Arten von Demonstrativkonsum. Und genau dafür muß mit Einbußen bei ihrem Vermögenswert bezahlt werden.
JÜRGEN KAUBE
Bruno S. Frey: "Arts & Economics: Analysis & Cultural Policy". Springer Verlag, Heidelberg 2000, 240 S., 98 Mark.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main