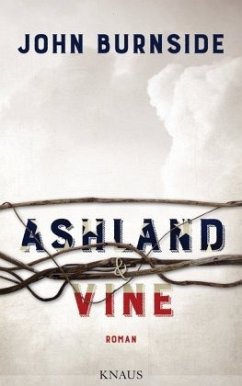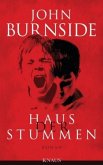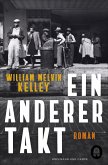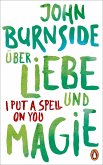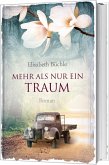John Burnsides großer Roman über Amerikas verdrängte Traumata
Mit dem Mord an ihrem Vater, Rechtsanwalt und Gegner der Rassentrennung, endet jäh die behütete Kindheit der jungen Jean und ihres Bruders Jeremy. In der Lebensgeschichte der beiden Geschwister spiegeln sich die politischen Entwicklungen, die in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts Amerika tief gespalten haben: von der Kommunistenhatz der McCarthy-Ära über die erstarkende Bürgerrechtsbewegung zur Black Panther Party, Vietnam und dem Kalten Krieg. Als der Traum von einer gerechten Welt in immer weitere Ferne rückt, zieht sich Jean in die Einsamkeit zurück. Bis eines Tages eine junge, alkoholkranke Frau vor ihrer Tür steht und ihre Hilfe braucht.
In seinem neuen Roman erzählt John Burnside die Geschichte einer Familie aus den amerikanischen Südstaaten: berührend und poetisch eindringlich.
Mit dem Mord an ihrem Vater, Rechtsanwalt und Gegner der Rassentrennung, endet jäh die behütete Kindheit der jungen Jean und ihres Bruders Jeremy. In der Lebensgeschichte der beiden Geschwister spiegeln sich die politischen Entwicklungen, die in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts Amerika tief gespalten haben: von der Kommunistenhatz der McCarthy-Ära über die erstarkende Bürgerrechtsbewegung zur Black Panther Party, Vietnam und dem Kalten Krieg. Als der Traum von einer gerechten Welt in immer weitere Ferne rückt, zieht sich Jean in die Einsamkeit zurück. Bis eines Tages eine junge, alkoholkranke Frau vor ihrer Tür steht und ihre Hilfe braucht.
In seinem neuen Roman erzählt John Burnside die Geschichte einer Familie aus den amerikanischen Südstaaten: berührend und poetisch eindringlich.

© BÜCHERmagazin, Elisabeth Dietz (ed)

Hier spricht nicht nur der Autor, hier sprechen auch die Namen: John Burnside erzählt in seinem neuen Roman "Ashland & Vine" vom Weg einer aus der Bahn geratenen Frau zurück in die Welt.
Verschwitzt, planlos und fürchterlich verkatert wankt die eine Frau ins Leben der anderen, und so wie sich die Dinge dann entwickeln, möchte man diese Begegnung schicksalhaft nennen. Zumindest für Kate, die amerikanische Studentin, die in diesem Sommer 1999 entschieden zu viel trinkt und nun vor der Tür der straffen, knapp siebzigjährigen Joan Culver steht, bedeutet dieser Moment einen Wendepunkt: "Ehrlich gesagt, ich brauchte eine Pause", so kommentiert Kate das aus der Rückschau, und das klingt in ihrer Situation wie der Satz, der in der Ratgeberliteratur gern als erster Schritt auf dem Weg aus einer verfahrenen Situation empfohlen wird: "Ich brauche Hilfe."
Eigentlich sollte Kate in diesem Sommer als Mitarbeiterin in einem Projekt ihres Freundes Laurits von Tür zu Tür gehen und sich von den Bewohnern anhand eines Fragenkatalogs Lebensgeschichten erzählen lassen. Joan Culver erklärt sich dazu auch bereit, allerdings erst bei einem nächsten Treffen fünf Tage später. Ihre Bedingung ist, dass Kate bis dahin keinen Alkohol anrührt. Zu ihrer eigenen Überraschung stimmt sie zu, und in der Folge kommt es zwischen den beiden Frauen zu wechselseitigen biographischen Erzählungen - dem Kern von John Burnsides neuem Roman "Ashland & Vine".
Joan berichtet von einer Kindheit im Bundesstaat Virginia, vom Sterben der Mutter und dem Bemühen des Vaters, ihr und ihrem Bruder Jeremy trotzdem eine halbwegs glückliche Kindheit zu ermöglichen. Dann wird er auf offener Straße erschossen, weil er sich als Rechtsanwalt offenbar dem mafiosen Geflecht der städtischen Oberschicht widersetzte, was weitgehend ungesühnt bleibt - der erste von vielen Kratzern auf dem Idealbild einer freien, gleichen und gerechten amerikanischen Gesellschaft, die in diesem Roman als Erfahrungen der Protagonisten gezeigt werden.
Auch Kate ist bei einem alleinerziehenden Vater aufgewachsen, denn ihre Mutter verschwand einfach, als das Mädchen sechs Jahre alt war. Sein Tod wirft die junge Studentin völlig aus der Bahn, sie zieht mit dem manipulativen Filmwissenschaftler Laurits zusammen und gerät in einen Kreislauf aus Alkohol und Paranoia, der sie in jeder Hinsicht lähmt. An Joans Seite nun bleibt sie trocken, lernt das einfache Leben zu schätzen, das die ehemalige Gärtnereibesitzerin nun führt, und begibt sich gedanklich immer wieder zurück, um den Punkt zu ergründen, von dem aus ihr Leben damals aus der Bahn geriet, angetrieben durch "diese nagende Erinnerung, eine, die besagte, ich sei tatsächlich einst glücklich gewesen und könne, darauf aufbauend, auch wieder glücklich werden". Darin bestärken sie die Spaziergänge mit Joan durch die Stadt, etwa wenn sie vor einer Buchhandlung stehen, deren Schaufenster ausgerechnet Kates Lieblingskinderbücher zeigt. "Es war", sagt sie, "als wäre ich zu einer langen Busreise aufgebrochen und hätte irgendwo unterwegs den Anschluss verpasst."
Spätestens an dieser Stelle ist unübersehbar, dass Burnside, vertreten durch die Erzählerin Kate, eine moderne Erlösungsgeschichte im Sinn hat, in der alle Elemente nur zu gut zusammenpassen. Die Heilung kommt, als Kate, nun nicht mehr benebelt, der Vergangenheit mit ihren Verlusten ins Auge schaut, aber auch indem sie an der Seite der beharrlichen Alten lernt, vegetarisch zu leben, und zwar gern, "gab es doch so viele leckere Alternativen". Eingekauft wird in kleinen Bioläden, da macht es wieder Spaß, und auch im Studium läuft es besser, nachdem sie von dem inzwischen unter dramatischen Umständen verstorbenen Laurits zu Jean in deren großes Haus gezogen ist. Zumal die weiß: "Jeder muss trauern, nur kommt es darauf an, damit nicht auch gleich alles andere fortzuwerfen."
Derlei Erkenntnisse hat Jean nicht exklusiv, sie ist einer von mehreren, meist alten Menschen, die mit ihrer Lebenserfahrung nicht hinter dem Berg halten: "All die Jahre", so seufzt ein bejahrter Ex-Spion, "in denen wir uns genötigt fühlen, unser Leben für - Zeug herzugeben. Für Geld. Erfolg. Renommee. All die Jahre, in denen wir nicht begriffen haben, dass der einzig lohnenswerte Besitz Zeit ist." Eine Ansicht, die sich Kate schließlich so ausdrücklich zu eigen macht, dass man trotz ihrer materiell durchaus unsicheren Lage nicht weiter um sie bangt.
Drängender ist die Frage, ob John Burnside, Lyriker von Gnaden, Autor faszinierender autobiographischer Prosa und beeindruckender Romancier, diese allzu glatte Geschichte mit ihren Kalendersprüchen eigentlich so ernst meint, wie sie daherkommt, und hier nicht zuletzt die bequeme Verteilung von Gut und Böse. Reicht es beispielsweise, die Erfahrungen der Protagonisten aus Vietnam und den Demonstrationen gegen den Parteitag der Demokraten im Jahr 1968 zu referieren oder das sadistische Gebaren der FBI-Mitarbeiter, um "das System" für alles Mögliche verantwortlich zu machen? Warum werden die naheliegenden Botschaften über Schmerz und Heilung nicht nur gezeigt, sondern immer auch noch erklärt, manchmal zwei- oder dreimal? Und was hat es mit den Namen von Orten und Protagonisten auf sich, die zuverlässig sprechen und ein Verweissystem bedienen?
Das beginnt mit dem Namen jener Stadt, in der sich das Geschehen abspielt und die sich, Scarsville getauft, geradezu als Aufenthaltsort für all die Verletzten aufdrängt, und es endet keineswegs mit der Nebenfigur einer Gärtnereiangestellten, die sich mit dem berühmten Blumenmädchen Eliza Doolittle aus "My Fair Lady" den Vornamen teilt. Viele dieser Namen beziehen sich auf Ornithologisches - Jean Culver, der Nachname verweist auf die Waldtaube, wohnt in der Audubon Road, benannt nach dem berühmtesten amerikanischen Vogelmaler überhaupt. Eine "halbanimalische", wie Kate findet, Besucherin ist die zehnjährige Christina Vogel, von der nach Jeans Tod nichts mehr zu sehen ist, und ein hübscher, offensichtlich verliebter Junge heißt Alan Swann, in diesem Kontext nicht nur auf Prousts Figur, sondern auch auf die Vogelwelt deutend. Das ist kein Zufall bei einem Autor, der sich schon länger als ornithologisch interessiert gezeigt hat, aber warum häuft sich das hier?
Eine Antwort könnte sein: Weil nichts, was hier eine Rolle spielt, außerhalb eines Kosmos von Geschichtenerzählern zu denken ist. Der Roman hebt damit an und endet damit, dass eine letzte Geschichte nachgetragen wird, er fordert dazu auf, sich seiner eigenen Geschichte ebenso bewusst zu werden wie der des Landes, aber auch, sich daran zu erinnern, dass Erzählen stets Formen heißt, dass es keine Wahrheit gibt außer derjenigen, die man seiner Perspektive erzählend verleiht.
Denn auch darum geht es in diesem Roman: wie das Verweigern der Erzählung oder das Ausweichen in Märchen oder harmlose Geschichten buchstäblich Unglück erzeugt, wie es ratlose Zuhörer hinterlässt, die mit denen, die gegangen sind, keinen Frieden machen können, weil die entscheidende Geschichte fehlt. Wer - wie Laurits - seine Umgebung nur mit offensichtlichen Lügen abspeist, wenn es um die eigene Herkunft geht, und Filme hasst, die eine nacherzählbare Handlung haben, der tritt notwendigerweise mit den Worten ab, das zwischen ihm und den anderen sei "nichts Persönliches" gewesen. Wie könnte es auch anders sein?
Jeans kriegsversehrter Bruder Jeremy, so heißt es einmal, "wollte einen Sinn in Ereignissen finden, in denen kein Sinn zu finden war. Also entschied er sich für die Fiktion." Das macht die Dinge nicht besser, und am Ende ist auch er einer der vielen in diesem Roman, die einfach verschwinden. Kate aber, so scheint es, ist auf dem Weg zurück in die Welt. Das zu zeigen war erkennbar das Anliegen des Autors. Ob man seine Mittel nun akzeptiert oder nicht.
TILMAN SPRECKELSEN
John Burnside: "Ashland & Vine".
Roman.
Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Albrecht Knaus Verlag, München 2017. 416 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Glänzend erzählte Geschichte um zwei Frauen und ein halbes Jahrhundert.« Buchkultur
»'Ashland & Vine' kann sich mit den großen amerikanischen Klassikern messen.« The Times