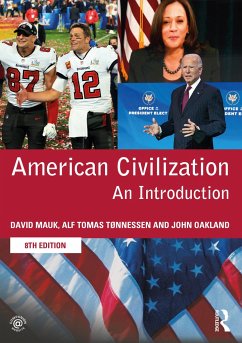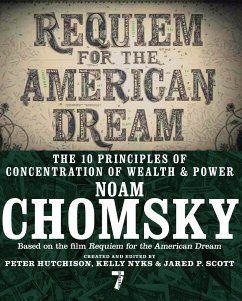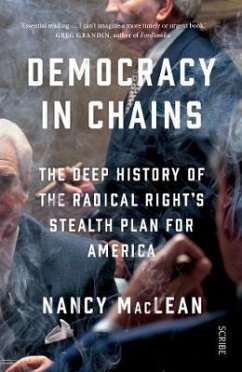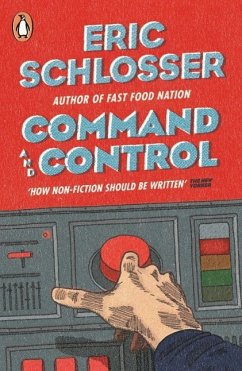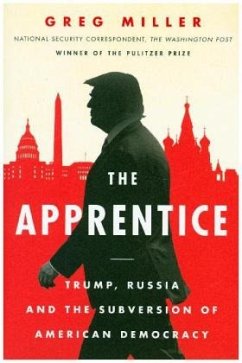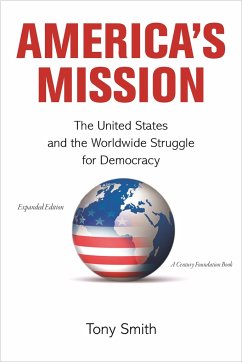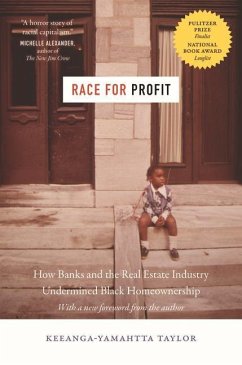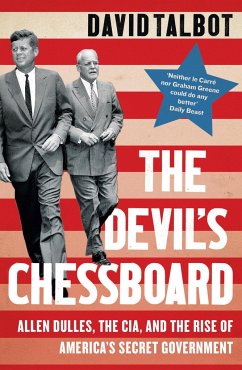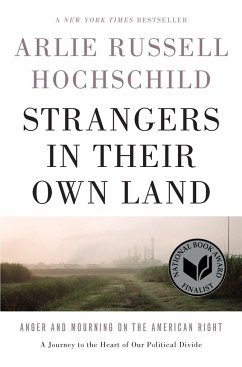Nicht lieferbar
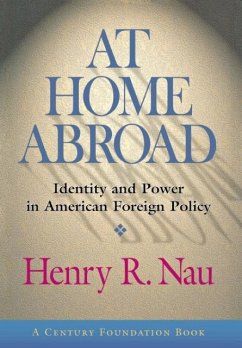
At Home Abroad
Identity and Power in American Foreign Policy
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
The United States has never felt at home abroad. The reason for this unease, even after the terrorist attacks of September 11, 2001, is not frequent threats to American security. It is America's identity. The United States, its citizens believe, is...