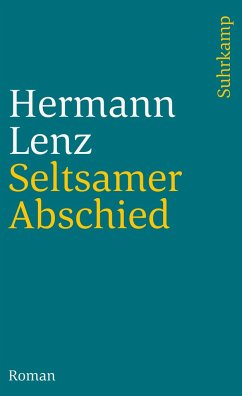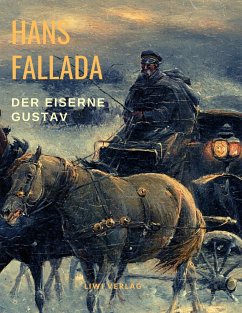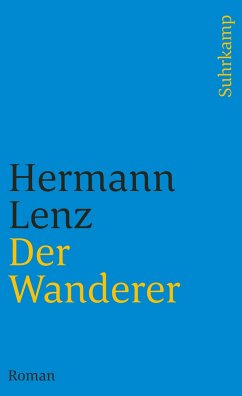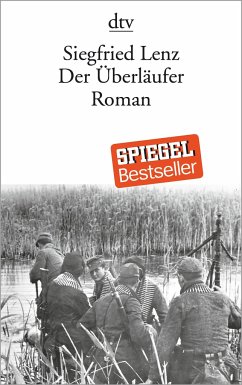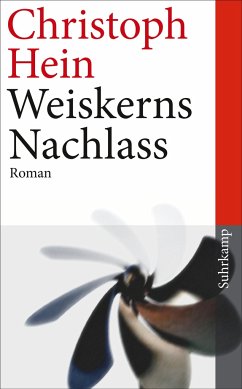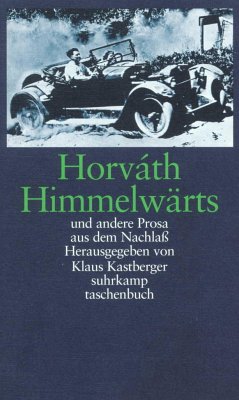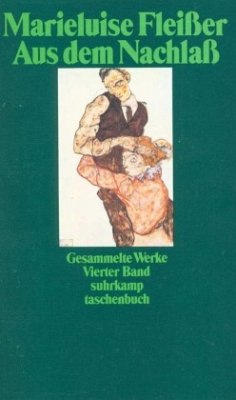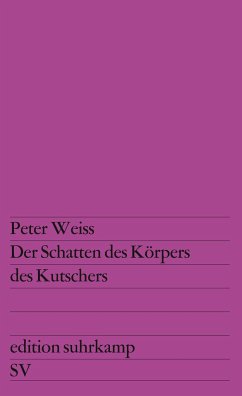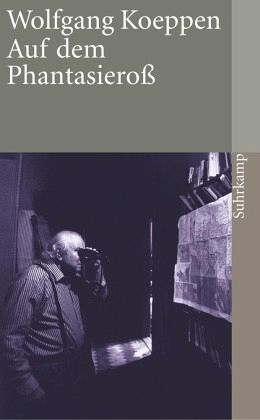
Wolfgang Koeppen
Broschiertes Buch
Auf dem Phantasieroß
Prosa aus dem Nachlaß
Herausgegeben: Estermann, Alfred
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte
3 °P sammeln!




Der erste Band erzählender Prosa aus dem Nachlaß mit bisher 170 unveröffentlichten Texten zeigt die durch die Jahrzehnte ungebrochene Fabulierfähigkeit Wolfgang Koeppens. Enthalten sind u. a. frühe Versuche aus dem Jahr 1923 bis hin zu Im Hochsitz, der letzten veröffentlichten Erzählung.
Koeppen, WolfgangWolfgang Koeppen wurde am 23. Juni 1906 in Greifswald geboren und starb am 15. März 1996 in München. Nach einem elfjährigen Aufenthalt in Ortelsburg (Ostpreußen) kehrte er 1919 nach Greifswald zurück. Aus finanziellen Gründen musste er vom Gymnasium auf die Mittelschule wechseln, von der er ohne Abschluss abging. Danach versuchte er sich in ganz unterschiedlichen Berufen: in einer Buchhandlung, im Stadttheater in Greifswald. Als Hilfskoch kam er nach Schweden und Finnland, in Würzburg arbeitete er als Dramaturg. 1927 ließ er sich in Berlin nieder, wo er 1931 zwei Jahre als fest angestellter Redakteur beim Berliner Börsen-Courier arbeitete. Er schrieb Reportagen, Feuilletons, auch erste literarische Arbeiten entstanden. 1934 erschien sein erster Roman, Eine unglückliche Liebe. Im selben Jahr siedelte er in die Niederlande über. Hier begann er mit der Niederschrift des nicht vollendeten Romans Die Jawang-Gesellschaft. 1935 erschien der Roman Die Mauer schwankt, der
jedoch kaum beachtet wurde. Er kehrte 1938 nach Deutschland zurück und arbeitete ab 1941 für die Bavaria-Filmgesellschaft in Feldafing am Starnberger See, 1945 siedelte er nach München über. 1948 erschien anonym das Buch Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch, zu dessen Neupublikation unter seinem Namen er erst 1992 zustimmte. 1951, 1953 und 1954 erschienen die drei Romane, die als die atmosphärisch genaueste Vergegenwärtigung des Klimas der Adenauer-Republik gelten: Tauben im Gras, Das Treibhaus und Der Tod in Rom. Koeppen verschaffte mit Nach Rußland und anderswohin, Amerikafahrt und Reisen nach Frankreich der Reiseliteratur in Deutschland hohes Ansehen.
jedoch kaum beachtet wurde. Er kehrte 1938 nach Deutschland zurück und arbeitete ab 1941 für die Bavaria-Filmgesellschaft in Feldafing am Starnberger See, 1945 siedelte er nach München über. 1948 erschien anonym das Buch Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch, zu dessen Neupublikation unter seinem Namen er erst 1992 zustimmte. 1951, 1953 und 1954 erschienen die drei Romane, die als die atmosphärisch genaueste Vergegenwärtigung des Klimas der Adenauer-Republik gelten: Tauben im Gras, Das Treibhaus und Der Tod in Rom. Koeppen verschaffte mit Nach Rußland und anderswohin, Amerikafahrt und Reisen nach Frankreich der Reiseliteratur in Deutschland hohes Ansehen.

Produktdetails
- suhrkamp taschenbuch 3679
- Verlag: Suhrkamp
- Artikelnr. des Verlages: ST 3679
- Seitenzahl: 779
- Deutsch
- Abmessung: 37mm x 118mm x 190mm
- Gewicht: 522g
- ISBN-13: 9783518456798
- ISBN-10: 3518456792
- Artikelnr.: 12799014
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für