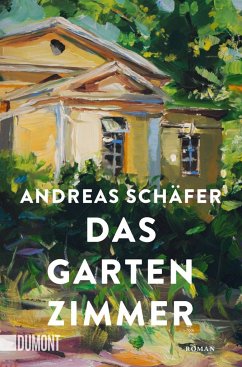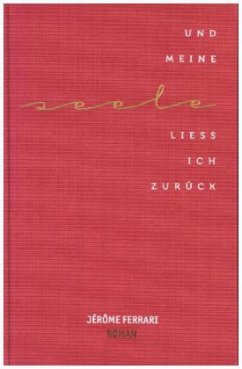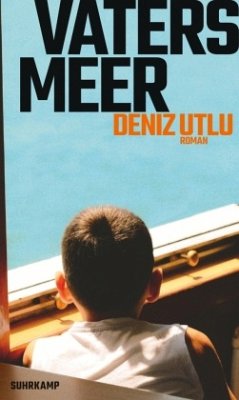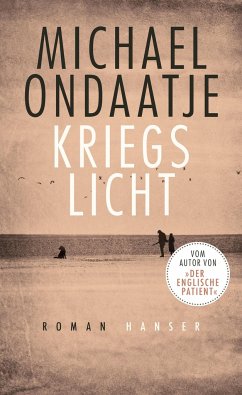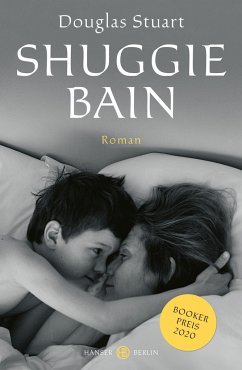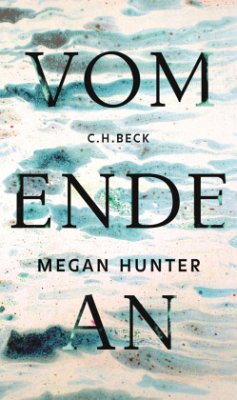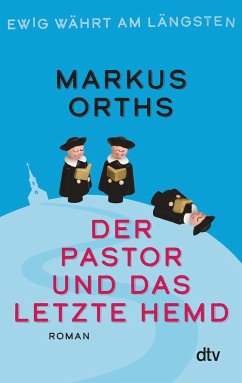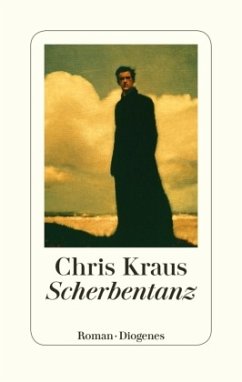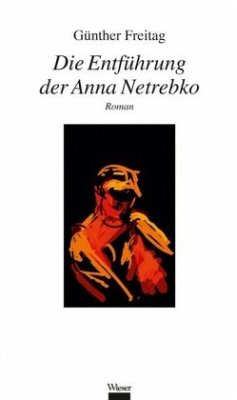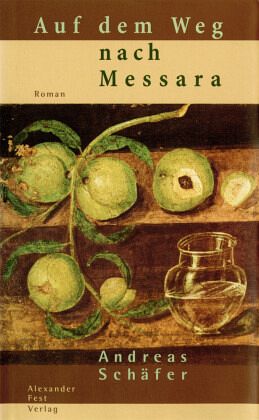
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Ein junger Mann reist zur Beerdigung seines Großvaters in eine kleine griechische Stadt und begegnet dort: seiner Mutter. Dieser atmosphärisch dichte, sprachlich fein gearbeitete Roman einer deutsch-griechischen Familie entführt den Leser in den Sommer und ans Meer - und in die Abgründe und Hoffnungen einer Liebe.
Geboren 1969, deutsch-griechischer Herkunft. Er wuchs in Frankfurt am Main auf und lebt heute in Berlin. "Auf dem Weg nach Messara" ist sein erster Roman.
Produktdetails
- Verlag: Fest
- Artikelnr. des Verlages: 15033
- 1. Auflage
- Seitenzahl: 192
- Erscheinungstermin: 22. März 2002
- Deutsch
- Abmessung: 205.00mm
- Gewicht: 354g
- ISBN-13: 9783828601543
- ISBN-10: 3828601545
- Artikelnr.: 10303151
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Andreas Nentwich bespricht einen seiner Ansicht nach "vielversprechenden Debutroman" des in Berlin lebenden deutsch-griechischen Autors Andreas Schäfer. Der Roman, in dem es um ein Zusammentreffen einer deutsch-griechischen Familie in Griechenland anlässlich der Beerdigung des Großvaters geht, besteche besonders durch die scharf gezeichneten Charakterprofile. Der Rezensent spricht von einer "nüchternen Elegie", die ein Griechenland zeige, das jenseits aller Klischees liege, und ist gespannt auf das nächste Werk dieses Autors.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für