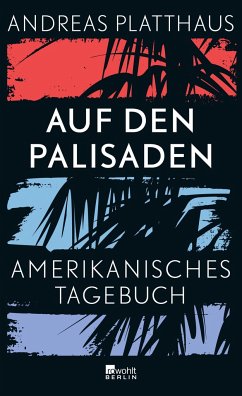Vier Monate im Haus von Thomas Mann in Pacific Palisades - das verändert den Blick auf Amerika und Deutschland gleichermaßen. Von hier aus begibt sich Andreas Platthaus ins weite Land, auf die Spuren des deutschen Exils, während er gleichzeitig den aktuellen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten auf den Grund geht: An der West- wie der Ostküste, von der mexikanischen Grenze tief in der Wüste bis zu den Millionärsvillen hoch über dem Pazifik, in Disneyland genauso wie auf den Straßen zwischen Obdachlosen sucht ein Alteuropäer nach dem Code der Neuen Welt. Er wählt eigene Wege durch das globale gesellschaftliche Versuchslabor, das Los Angeles darstellt, und zieht die Werke von Gewährsleuten wie Thomas Mann und Quentin Tarantino heran, die ein Amerika imaginiert haben, wie wir es nie für möglich gehalten hätten, aber nun erleben.
Vor dem Horizont der Präsidentschaftswahl im Herbst 2020 fühlt Andreas Platthaus unserem transatlantischen Gegenüber den Puls. In seinem Amerikanischen Tagebuch, entstanden «auf den Palisaden», begegnet uns ein tief gespaltenes Land - mit dem wir, mehr als sieben Jahrzehnte nach der Zeit des deutschen Exils, noch immer untrennbar verbunden sind.
Vor dem Horizont der Präsidentschaftswahl im Herbst 2020 fühlt Andreas Platthaus unserem transatlantischen Gegenüber den Puls. In seinem Amerikanischen Tagebuch, entstanden «auf den Palisaden», begegnet uns ein tief gespaltenes Land - mit dem wir, mehr als sieben Jahrzehnte nach der Zeit des deutschen Exils, noch immer untrennbar verbunden sind.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Rezensentin Tabea Grzeszyk hat keinen Zweifel an der Beobachtungs- und Erzählgabe von Andreas Platthaus. Dass Platthaus, der als Fellow in Thomas Manns Schlafzimmer in Los Angeles residieren durfte, jeden der 124 Tage dort des Kommentars für würdig befindet und das dann auch noch veröffentlicht, erscheint ihr allerdings der Güte zu viel. Wenn der Autor von seinem Fenster aus die Parallelwelt mexikanischer Immigranten erkundet, kann Grzeszyk noch was lernen, sobald Platthaus jedoch langatmig seinen Frühsport thematisiert oder sich über störende Gerüche in der Idylle echauffiert, vermutet die Rezensentin Lagerkoller.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

ANDREAS PLATTHAUS, verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben dieser Zeitung, war im vergangenen Jahr einer der ersten Fellows des Thomas Mann House in Pacific Palisades, dem ehemaligen Exil-Wohnsitz des Literaturnobelpreisträgers am Rande von Los Angeles. Vier Monate lang hat Platthaus jeden Tag eine ihn faszinierende Beobachtung aus dem amerikanischen Leben aufgeschrieben: über Begegnungen, Museumsbesuche, politische Ereignisse, Reisen, Konzerte und Recherchen auf den Spuren des deutschen Exils. Dabei entsteht nicht nur ein vielschichtiges Porträt der Stadt Los Angeles, sondern auch eines der Vereinigten Staaten vor den diesjährigen Präsidentenwahlen: als Land im Zustand der wachsenden gesellschaftlichen Spaltung. (Andreas Platthaus: "Auf den Palisaden". Amerikanisches Tagebuch. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2020. 409 S., 5 Abb., geb., 24,- [Euro].)
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main