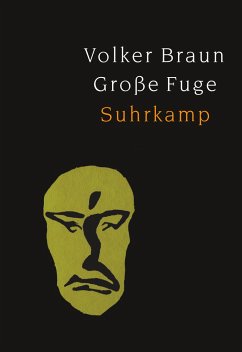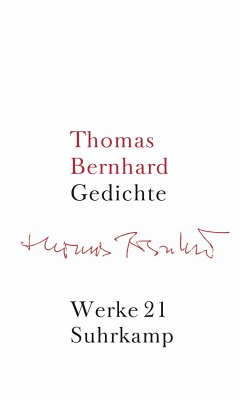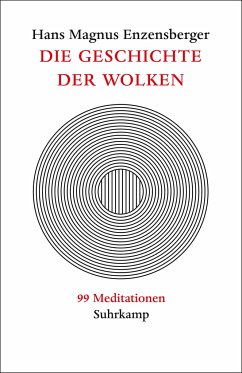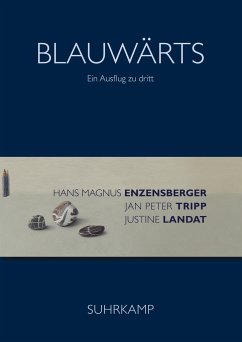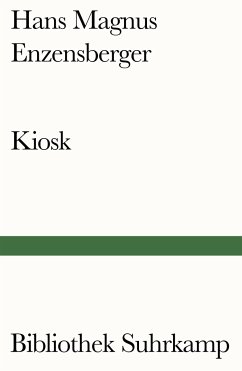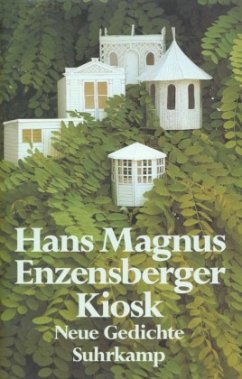Auf die schönen Possen
Gedichte
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
20,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Und frische Nahrung, neues Blut - nicht harmlos sind die Verse Volker Brauns zu lesen, und die Possen, die der Titel meint - das sind die ernsten Späße des Daseins selbst. Von nackten verborgenen Gebärden ist die Rede, Wettererscheinungen zwischen den Schläfen, dem Separatismus der Gefühle oder dem Schichtwechsel ins Klassenlose. Es ist ein altes zerfahrenes Land, in dem der Dichter steht, aber auf Einsteins Wiese hegt er diese leichtbewegten, Gedanken ans Einfachste.»Was ist das lähmende Bewußtsein, daß alles ins Nichts läuft, gegen die Kraft der Sinne, die Lust, das Entsetzen. Ich ...
Und frische Nahrung, neues Blut - nicht harmlos sind die Verse Volker Brauns zu lesen, und die Possen, die der Titel meint - das sind die ernsten Späße des Daseins selbst. Von nackten verborgenen Gebärden ist die Rede, Wettererscheinungen zwischen den Schläfen, dem Separatismus der Gefühle oder dem Schichtwechsel ins Klassenlose. Es ist ein altes zerfahrenes Land, in dem der Dichter steht, aber auf Einsteins Wiese hegt er diese leichtbewegten, Gedanken ans Einfachste.»Was ist das lähmende Bewußtsein, daß alles ins Nichts läuft, gegen die Kraft der Sinne, die Lust, das Entsetzen. Ich bin, in meinen Fasern, nicht der Macht verhaftet. Apparate, Parteien und ihr abgelebter Geist, das mag zum Teufel gehn. Das macht mich lachen. Das hilft mir nicht. Meine Natur nährt eine rohere Kost.« - Wovon Braun in seiner Büchnerpreisrede sprach, in den jüngsten Gedichten ist es wiederum eingelöst. Mit formaler Fertigkeit tariert er die Verhältnisse, politische und intime, auf beiden Schultern tragend, und hält oder verliert das Gleichgewicht, während der Weltkreis wankt: ein Freudenelend / ist das Leben.