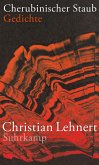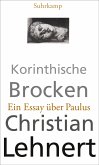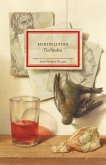"Wie ein Buchstabe, / aufgerissenes Auge, nicht von dem Buch wissen kann, / das ihn enthält, / kann ich nicht lesen, wo ich bin."Sie stellen sich den Fragen nach der eigenen Existenz: der Bausoldat, der sich in der monotonen Plackerei auf Rügen zwischen "Gleichschritt" und "Normzeit" abhanden zu kommen droht; der Anpassungsvirtuose Erich Mielke, für den das Wort Ich ein "bloßes Stochern im Dunkel" ist; oder Apostel Paulus, der auf das Kommende vertraut und das Hier und Jetzt als Zwischenzustand begreift.Auf Moränen erklingen diese Stimmen, unter ihnen ein Berg von Erlebnissen und Geschichte, Gedankengeröll, das sich übereinanderschiebt. Christian Lehnert spürt in seinen Gedichtzyklen tastend, drängend den Identitätsfragen nach, wie sie vom Urchristentum bis in die Gegenwart reflektiert werden, und entfaltet "ein Wortgewebe voll dunklem Glanz" (Gerhard Kaiser).

Kryptomessianische Poesie von Christian Lehnert
Richtig gute Lyriker gibt es höchstens eine Handvoll. Christian Lehnert gehört auf jeden Fall dazu. In seinem neuesten Gedichtband "Auf Moränen" mustert er den Sprachschutt, der nach dem Abschmelzen des Ostblock-Gletschers übrig geblieben ist. Das meiste ist gewöhnlicher Dreck, aber vereinzelt finden sich schöngemusterte Kiesel darin. Es stellt sich die Frage: Liegt irgendwo in der Sprache noch ein Rest jener Verheißung, die es doch einmal gab, ziele sie nun auf eine bessere Welt oder auf die Erlösung überhaupt?
Im ersten der vier Teile, der mit "Zungenreden" überschrieben ist, beschwört Lehnert traumatische Bilder aus seiner Zeit als Bausoldat in Prora auf Rügen herauf, um darin nach Spuren der Nächstenliebe zu suchen. Aber in den DDR-Kasernen herrschte kein Verständnis, auch im Rückblick nicht, da war steinernes Schweigen und betonharte Einsamkeit, "nur die Möwen erkannten ihren Nächsten in ihm". Die Möwenschreie werden zum Bild der Opposition gegen den Dämon der DDR-Sprache. Wie zerrissene Wolken wirbeln Bruchstücke der christlichen Apokalyptik in den Prora-Gedichten herum. Blitzartig öffnet sich der Himmel zu einem "Amen, Herr, komme bald!", das sogleich wieder verschwindet.
Den zweiten Teil kann man vereinfacht "Mielke-Gedichte" betiteln, nach Erich Mielke, dem einstigen Minister für Staatssicherheit, dem die Lüge zur zweiten Haut geworden war. Mielke glaubte stets an das jeweils Verordnete. Auch die eigene Biographie frisierte er je nach der politischen Lage um. "Es ist so, / dass wir nur dann der Wahrheit dienen, / wenn wir immer neu festlegen, was wir glauben, / und was gewesen ist." Das Lügengespinst hat allen Glauben, alles Erinnern und jedweden Wahrheitsdiskurs auf unbestimmte Zeit verdorben.
"Vigilien", also Nachtwachen, ist der dritte Teil überschrieben. Das Wachen und Warten gilt dem Messias. Wann kommt er? Christian Lehnert gibt nicht die alten, verbrauchten und missbrauchten Antworten. Nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt wird er kommen, sondern außerhalb der Zeit ist er und wird er sein: "Die Zeit vermag keine Wunde zu heilen. / Nein, solange die Zeit ist, keine Heilung." Man muss heraus nicht nur aus der Zeit, sondern sogar aus dem Glauben. Man muss glauben, als glaubte man nicht.
Die Gedichte der vierten Gruppe, unter denen viele bedeutende sind (zum Beispiel das im Brentano-Ton geschriebene Sonett "Herbstzeitlose"), vertiefen das mystische Paradox. Lehnert schwärmt von den ersten sechs Lebensmonaten, in denen das Kind noch nichts von Zeit oder Worten weiß. Auch Christi Geburt beschreibt er, in einer schockierend antiidyllischen Sprache, beginnend mit der Zeile "Unerwartet der Schwall Blut und das schwarze, kaum erträgliche Köpfchen."
Im Moränengeröll findet man auch das Wort "Gott", aber es ist zu nichts mehr zu verwenden außer: es leer zu halten, leer zu halten sogar "um den Preis des Verstehens". Denn Gott fällt nicht unter unsere Begriffe. Es gibt immer noch vieles, sagt Lehnert im Gedicht, worauf man sich blind verlassen müsse, "dass die Erde auftaut im April", und "dass die schweren Wurzeln des Nussbaums nicht in meine Seele übergreifen", und "dass Gedächtnis und Begehren nicht von innen den Körper aufbohren".
HERMANN KURZKE
Christian Lehnert: "Auf Moränen". Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. 134 S., geb., 16,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Für Rezensent Hermann Kurzke gehört Christian Lehnert zu der Handvoll guter Lyriker überhaupt. Allerdings fällt Kurzkes Argumentation dazu nicht allzu üppig aus. Die hübschen Kiesel im "Sprachschutt" des abgeschmolzenen Ostblocks, die er in den Texten entdeckt, können es allein nicht sein. Vielleicht die gottlose Einsamkeit, die der Autor in "traumatischen Bildern" vermittelt. Kurzke stößt auf sie unter anderem in den Gedichten aus Lehnerts Zeit als Bausoldat in Prora, als Möwen dem Autor die besseren Gesprächspartner waren. Wie die Lüge des politischen Systems sich in der Sprache manifestiert, scheinen die Gedichte mit ihrer "antiidyllischen" Sprache ebenfalls gut zu transportieren.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Richtig gute Lyriker gibt es höchstens eine Handvoll. Christian Lehnert gehört auf jeden Fall dazu.« Hermann Kurzke Frankfurter Allgemeine Zeitung 20080516