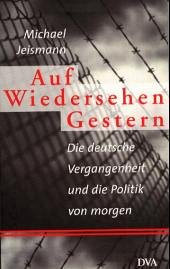Der Umgang mit der Erinnerung an den Holocaust hat in den letzten Jahrzehnten deutsche Identität und deutsche Politik wesentlich bestimmt. Seit der Einheit weichen Gewißheiten auf und werden Tabus angegriffen. Wohin geht Deutschland?
Deutschland steht an einem Scheidepunkt: Die Folgen der Einheit sind noch nicht bewältigt. Die Kriegs- und Tätergeneration stirbt allmählich. Die internationale Stellung des Landes hat sich geändert. Rechtsradikalismus nimmt dramatisch zu. Das Verhältnis zur Vergangenheit wird heftig debattiert - etwa im Streit um das Holocaust-Mahnmal, in der Walser-Bubis-Debatte, in den Auseinandersetzungen um die Bücher von Goldhagen und Finkelstein. Michael Jeismann analysiert die Folgen dieses Wandels für die politische Kultur der neuen Bundesrepublik und ihrer europäischen Nachbarn.
Deutschland steht an einem Scheidepunkt: Die Folgen der Einheit sind noch nicht bewältigt. Die Kriegs- und Tätergeneration stirbt allmählich. Die internationale Stellung des Landes hat sich geändert. Rechtsradikalismus nimmt dramatisch zu. Das Verhältnis zur Vergangenheit wird heftig debattiert - etwa im Streit um das Holocaust-Mahnmal, in der Walser-Bubis-Debatte, in den Auseinandersetzungen um die Bücher von Goldhagen und Finkelstein. Michael Jeismann analysiert die Folgen dieses Wandels für die politische Kultur der neuen Bundesrepublik und ihrer europäischen Nachbarn.

F.A.Z.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Nicht mehr nur Gegenwart und Zukunft sind global, jetzt wird auch die Vergangenheit globalisiert. Besonders auffallend an den jüngsten Holocaust-Debatten sei, schreibt Edgar Wolfrum in seiner Rezension des Buches "Auf Wiedersehen Gestern" von Michael Jeismann, dass ihr Gegenstand nicht mehr deutsches Verhalten und deutsche Taten sind. "Es gibt eine globalisierte Arbeit an der Formung kollektiver Gedächtnisse", stellt Wolfrum fest: Der Holocaust werde im politischen Tagesgeschäft zunehmend "als Grundlage einer gebrauchsfähigen gemeinsamen europäischen Vergangenheit genutzt". Als Beispiel dient hier die Stockholmer Holocaust-Konferenz. Der Rezensent lässt leider etwas im unklaren, ob es sich dabei um seine eigenen schlauen Gedanken handelt oder um Jeismanns. Von Jeismann jedenfalls, soviel wird deutlich, stamme eine "schlüssige" Beschreibung des Wandels im deutschen Geschichtsbild: Das Holocaust-Mahnmal veranschauliche nicht nur, dass die Geschichte des Holocaust inzwischen zum repräsentativen Selbstverständnis der Bundesrepublik gehört, sondern auch das Ende der Befangenheit. Schließlich moniert Wolfrum den assoziativen Stil des Autors: "Als Leser weiß man nicht immer, wo sich der Autor gerade aufhält."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH