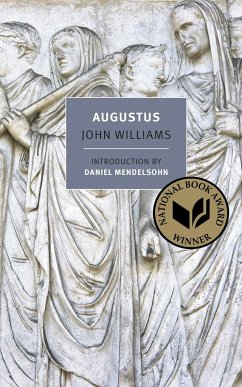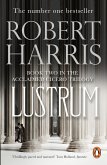WINNER OF THE 1973 NATIONAL BOOK AWARD
By the Author of Stoner
In Augustus, his third great novel, John Williams took on an entirely new challenge, a historical narrative set in classical Rome, exploring the life of the founder of the Roman Empire. To tell the story, Williams turned to the epistolary novel, a genre that was new to him, transforming and transcending it just as he did the western in Butcher s Crossing and the campus novel in Stoner. Augustus is the final triumph of a writer who has come to be recognized around the world as an American master.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
By the Author of Stoner
In Augustus, his third great novel, John Williams took on an entirely new challenge, a historical narrative set in classical Rome, exploring the life of the founder of the Roman Empire. To tell the story, Williams turned to the epistolary novel, a genre that was new to him, transforming and transcending it just as he did the western in Butcher s Crossing and the campus novel in Stoner. Augustus is the final triumph of a writer who has come to be recognized around the world as an American master.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ein Zoom auf die Antike: John Williams lässt in seinem Roman "Augustus" von dem Mann erzählen, der Rom groß machte. Nach 44 Jahren erscheint das Buch erstmals auf Deutsch
Wer soll das lesen? Ein Buch, das vor 44 Jahren erschienen ist und jetzt erstmals auf Deutsch herauskommt? Dessen Autor seit mehr als zwanzig Jahren tot ist? Ein Buch, das in Form eines historischen Romans vom römischen Princeps Augustus erzählt, zu dessen 2000. Todestag vor zwei Jahren pflichtschuldig die eine oder andere Studie veröffentlicht wurde? Soll man das also lesen? Unbedingt, natürlich, selbst dann, wenn einem römische Geschichte bestenfalls aus "Gladiator" bekannt ist und schlimmstenfalls als lästige Plage aus dem Lateinunterricht.
Denn der Autor John Williams ist einer der großen, lange übersehenen amerikanischen Schriftsteller in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der erst vor ein paar Jahren wiederentdeckt, um nicht zu sagen: entdeckt wurde. Vier Romane hat er geschrieben, ein Spätwestern ist darunter, "Butcher's Crossing", und ein großartiger Campusroman, "Stoner". Und eben "Augustus", für den Williams 1973 den National Book Award erhielt. Was sofort die Frage nach sich zieht, wie ein Mann aus dem tiefsten ländlichen Texas, der sein Studium abbrach und als Journalist arbeitete, bevor er weiterstudierte und Literaturdozent wurde, wie ein Autor, dessen übrige Romane so unverwechselbar von Americana handeln, darauf kommt, ausgerechnet über die römische Antike zu schreiben.
Viel ferner von Texas könnte sie kaum sein, vielleicht ist das gerade der Reiz, die Herausforderung durch das Unbekannte und Fremde. Williams sei, so kann man lesen, durch einen Bekannten darauf gekommen, der ein Buch über die Geschichte der Liebe seit der Antike geschrieben hatte. Der hatte ihm von Julia erzählt, dem einzigen Kind von Gaius Octavius, wie er hieß, bevor er sich Caesar nannte und Augustus genannt wurde. Julia wurde von ihm drei Mal mit machtpolitischem Kalkül verheiratet, zuletzt an den späteren Princeps Tiberius, und sie wurde schließlich von ihrem Vater verbannt auf die Insel Pandateria, heute Ventotene. Wegen ihres Lebenswandels, wegen ihrer Liebhaber, wegen der Beteiligung an einer Verschwörung - so genau und verlässlich ist das aus den wenigen Quellen nicht zu ermitteln.
Für Williams war das Verhältnis von Tochter und Vater, war die Spannung zwischen privaten Wünschen und öffentlichen Pflichten offenbar der Schlüssel, um diese ferne Welt zu öffnen, und er hat sich, man muss das schon mit einem altmodischen Wort sagen, hingebungsvoll versenkt in diese Zeit, er hat sehr genau auf die Stimmen, die Tonlagen geachtet, wie sie aus den Briefen, Gedichten, Epen von Vergil, Horaz, Ovid, Cicero oder Caesar hörbar werden. Seine Phantasie hat sich von diesen Quellen entzünden lassen. Aber er war nicht so naiv, einen linearen historischen Roman möglichst dicht an den gesicherten Fakten zu schreiben.
Williams hat sich für die Form des Briefromans entschieden, weil eine durchgängige Erzählung zu simpel erschien und überdies genötigt hätte, eine Figur zu erklären oder sie sich ständig selbst erklären zu lassen. So kann er zwischen Perspektiven und Zeiten springen. "Ich wollte auch nicht den Blick des 20. Jahrhunderts auf römische Geschichte", hat er gesagt. Deshalb hat er alle Dokumente im Roman bis auf sehr, sehr wenige Passagen erfunden: die Briefe, die Memoirenauszüge, Senatsprotokolle, Tagebucheinträge, Schmähschriften oder Konsulatsbefehle. Und deshalb laufen auch alle Erbsenzählereinwände gegen historische "Fehler" von vornherein ins Leere, deshalb können wichtige Personen einfach aus der Geschichte herausgekürzt werden, und andere erhalten dafür eine Stimme und eine Rolle, über die kaum etwas bekannt ist.
Es schreiben und sprechen dann Vergil, Horaz oder Ovid, und es sind doch nicht Vergil, Horaz oder Ovid; man liest Auszüge aus den Memoiren Agrippas, Julias zweitem Ehemann und Erbauer des Pantheons in Rom; Briefe von Maecenas an den Historiker Livius, von Marcus Antonius an Cleopatra, man liest in Julias Tagebuch, das sie in der Verbannung führte, verfolgt, wie Nikolaos von Damaskus, dessen Augustusbiographie verloren ist, per Brief recherchiert - und das Großartige an dieser Montage verschiedener Texte sind die feinen Schattierungen. Williams ist kein Stimmenimitator, er schafft es aber sehr gut, mal den leicht überheblichen Cicero-Ton zu treffen, mal die knappe, schlanke, nie parfümierte lateinische Prosa nachzubilden, er hat ein Auge für Gliederung und Sprache eines konsularischen Befehls oder einer Schmähschrift. Und er verzichtet auf antikisierende Wendungen wie auch auf die immer leicht lächerlich klingenden Modernisierungen, die wirken wie Cleopatra mit Prada-Tasche im Stadttheater. Die Übersetzung von Bernhard Robben hat dafür ein angemessenes deutsches Äquivalent gefunden. Und man kann schon sagen, dass Williams im Vergleich zu Marguerite Yourcenars Hadrian-Roman oder Gore Vidals "Julian" die bessere Figur macht.
Das Porträt des Augustus setzt sich aus vielen Facetten zusammen, der Porträtierte muss dabei noch nicht mal in jedem Eintrag vorkommen. Freunde, Feinde, Beobachter oder seine Ehefrau Livia erzählen, beschreiben, charakterisieren, kritisieren, drohen, hadern, spekulieren. Seine Jugendfreunde erinnern sich, wie er auf die Nachricht von Caesars Tod reagierte; sie registrieren seine wachsende Härte und Verschlossenheit. Andere zitieren ihn, und Julia, die Tochter, die am häufigsten von allen zu Wort kommt, schildert voller Bitterkeit die väterliche Heiratspolitik - "ich hatte drei Ehemänner, keinen habe ich geliebt . . ." - und ringt sich doch so etwas wie Verständnis ab, weil die Verbannung sie davor bewahrt, wegen Verschwörung angeklagt zu werden.
Es ist nicht weiter tragisch, dass Gaius Octavius' machtpolitische Strategie, seiner Alleinherrschaft die alte Fassade jener glorreichen Republik vorzublenden, die er am Ende der Bürgerkriege liquidiert hatte, dass die Details der Imperiumssicherung allenfalls am Rande vorkommen. Das ist Stoff für historische Analysen. Williams interessiert sich für die Person, die er an der Schnittstelle zwischen privatem und öffentlichem Raum beobachtet - wenn man denn überhaupt mit diesem modernen Begriffspaar operieren will. Und deswegen lässt er im dritten Buch des Romans schließlich auch Augustus selbst in einem Brief an seinen Biographen sprechen, durchsetzt mit ein paar Auszügen aus den "Res gestae divi Augusti", die nahezu vollständig erhalten sind.
Es ist ein langer Brief zum kurzen Abschied, geschrieben auf einem Schiff, das von Ostia nach Capri segelt, ein paar Tage vor dem Tod des Princeps im Jahr 14. Weil es unvermeidlich ist, dass man beim Blick zurück auf eine ferne Welt nicht frei von Projektionen bleibt, weil man instinktiv dazu neigt, das Fremde vertrauter aussehen zu lassen, ist es in einem Roman auch legitim, wenn in Augustus' Blick auf sein Leben bisweilen die Reflexivität eines auf sich selbst gestellten, modernen Subjekts durchschimmert.
Zur Affektlage, wie Historiker das nennen, eines Römers dieser Zeit, besser: zu dem, was wir über diese wissen, auch zum römischen Verständnis von Geschichtlichkeit und Subjektivität, passt das nicht so ganz, wenn der mächtigste Mann der damaligen Welt erklärt, für jeden komme der Moment, in dem er "die schreckliche Tatsache begreift, dass er allein ist, getrennt von allen anderen, und dass er niemand sonst sein kann als dieses arme Geschöpf, das er nun mal ist".
Das klingt verdächtig modern, diese Erkenntnis, dass ein Leben darin besteht, Möglichkeiten und Alternativen zu tilgen und in Taten und Fakten zu verwandeln. Augustus ist hier näher an William Stoner oder an Will Andrews aus "Butcher's Crossing". Die gern erzählte Legende, Augustus habe auf seinem Sterbebett gefragt, ob er seine Rolle gut gespielt habe, mag auf den ersten Blick zwar verlockend klingen wie eine moderne Reflexion über die Inszenierungen des Selbst und brüchige Identitäten - man sollte sich bloß hüten, das wörtlich zu nehmen, wenn es heißt, er habe wie ein Schauspieler so viele Rollen gespielt, "dass es ein Selbst gar nicht mehr gibt".
Das ist nun kein Einwand gegen diesen Roman, der sich seine poetischen Freiheiten nimmt, der einen Menschen in seine Zeit einbettet und zugleich mit den Augen des 20. Jahrhunderts prüft, was uns vertraut oder verwandt sein könnte. Wenn in "Stoner", so könnte man vereinfachend sagen, ein kleines Schicksal groß wurde, dann wird in "Augustus" eine weltgeschichtliche Gestalt klein in jenem Sinne, dass auch ein Imperium seinen Herrscher nicht aus der Umlaufbahn des Menschlichen herauskatapultiert. Williams' Verfahren gleicht einem Zoom: Er holt eine ferne Zeit heran, und dank der klugen Komposition, dank der Genauigkeit seiner Prosa wird diese Zeit, während man von ihr liest, anschaulich und lebendig - um danach wieder ihre alte Fremdheit anzunehmen.
PETER KÖRTE
John Williams: "Augustus". Roman. Übersetzt von Bernhard Robben. dtv, 476 Seiten, 24 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
The finest historical novel ever written by an American. The Washington Post
[In Augustus] John Williams re-creates the Roman Empire from the death of Julius Caesar to the last days of Augustus, the machinations of the court, the Senate, and the people, from the sickly boy to the sickly man who almost dies during expeditions to what would seem to be the ruthless ruler. He uses an epistolary format, and in the end all these voices, like a collage, meld together around the main character . . . Read it in conjunction with Robert Graves s more flamboyant I, Claudius and Marguerite Yourcenar s Memoirs of Hadrian. Harold Augenbraum, Executive Director of the National Book Foundation
A novel of extraordinary range, yet of extraordinary minuteness, that manages never to sacrifice one quality for the other. Financial Times
Williams has fashioned an always engaging, psychologically convincing work of fiction a consistent and well-realized portrait. Thomas Lask, The New York Times
"Readers of both Stoner and Butcher s Crossing will here encounter an altogether new version of the John Williams they ve come to know: Augustus is an epistolary novel set in classical Rome. It s a rare genius who can reinvent himself in his final work and earn high praise for doing so." The Millions
"Augustus is gripping, brimming with life." Dan Piepenbring, The Paris Review Daily
This novel of an aged emperor will be intensely illuminating to anyone who is ready to put modern morality aside for a moment in order to acquire a little knowledge of himself or herself The genius of this astonishing American writer is that he shows how lives that seem utterly strange can be very like our own. John Gray, New Statesman
[In Augustus] John Williams re-creates the Roman Empire from the death of Julius Caesar to the last days of Augustus, the machinations of the court, the Senate, and the people, from the sickly boy to the sickly man who almost dies during expeditions to what would seem to be the ruthless ruler. He uses an epistolary format, and in the end all these voices, like a collage, meld together around the main character . . . Read it in conjunction with Robert Graves s more flamboyant I, Claudius and Marguerite Yourcenar s Memoirs of Hadrian. Harold Augenbraum, Executive Director of the National Book Foundation
A novel of extraordinary range, yet of extraordinary minuteness, that manages never to sacrifice one quality for the other. Financial Times
Williams has fashioned an always engaging, psychologically convincing work of fiction a consistent and well-realized portrait. Thomas Lask, The New York Times
"Readers of both Stoner and Butcher s Crossing will here encounter an altogether new version of the John Williams they ve come to know: Augustus is an epistolary novel set in classical Rome. It s a rare genius who can reinvent himself in his final work and earn high praise for doing so." The Millions
"Augustus is gripping, brimming with life." Dan Piepenbring, The Paris Review Daily
This novel of an aged emperor will be intensely illuminating to anyone who is ready to put modern morality aside for a moment in order to acquire a little knowledge of himself or herself The genius of this astonishing American writer is that he shows how lives that seem utterly strange can be very like our own. John Gray, New Statesman