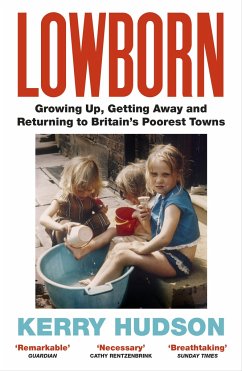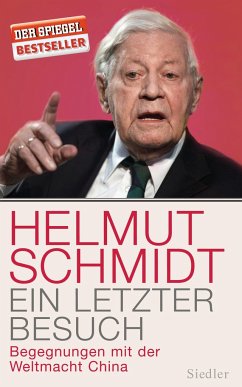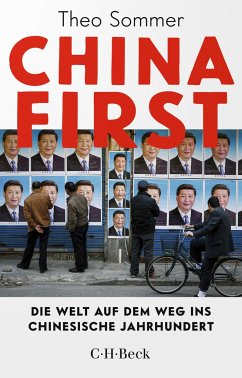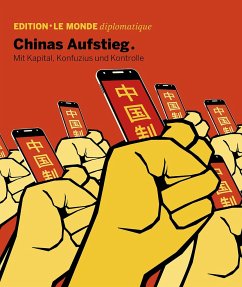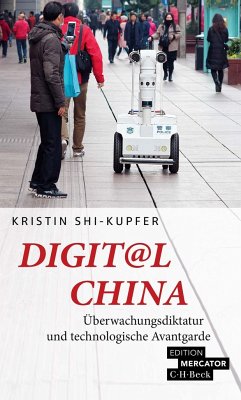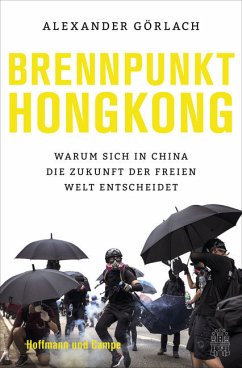Ausgewiesen
Über China
Übersetzung: Betz, Karin

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!
Im Westen hoch angesehen, im eigenen Land unerwünscht: Bei Ling - Verleger, Autor und Freund der Dissidenten Liu Xiaobo und Ai Weiwei - gibt in diesem autobiographischen Sachbuch Einblicke in die Mechanismen der chinesischen Staatsmacht, insbesondere der Zensur. Durch seine Arbeit als Verleger und Autor gerät er immer wieder ins Visier der Partei, 2000 wurde er von den chinesischen Sicherheitsbehörden verhaftet, weil er die regimekritische Literaturzeitschrift Tendenzen herausgegeben hatte; Susan Sontag und Günter Grass setzten sich erfolgreich für seine Freilassung ein.Nicht nur im eigen...
Im Westen hoch angesehen, im eigenen Land unerwünscht: Bei Ling - Verleger, Autor und Freund der Dissidenten Liu Xiaobo und Ai Weiwei - gibt in diesem autobiographischen Sachbuch Einblicke in die Mechanismen der chinesischen Staatsmacht, insbesondere der Zensur. Durch seine Arbeit als Verleger und Autor gerät er immer wieder ins Visier der Partei, 2000 wurde er von den chinesischen Sicherheitsbehörden verhaftet, weil er die regimekritische Literaturzeitschrift Tendenzen herausgegeben hatte; Susan Sontag und Günter Grass setzten sich erfolgreich für seine Freilassung ein.Nicht nur im eigenen Land will man ihm den Mund verbieten - von der Frankfurter Buchmesse wurde der Exilchinese 2009 als Podiumsgast zunächst ein-, dann auf Druck der offiziellen chinesischen Delegation wieder ausgeladen. In »Ausgewiesen« gibt Bei Ling Einblicke in den chinesischen literarischen Untergrund, erzählt von seiner Zeit in Gefangenschaft und davon, wie es ist, keinen heimatlichen Boden betreten zu dürfen