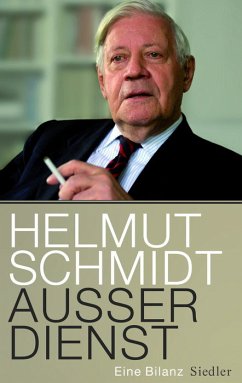In seinem Buch über die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Kanzleramt beschreibt Helmut Schmidt die umwälzenden historischen Entwicklungen seit dem Ende des Kalten Kriegs, er macht sich Gedanken über die gegenwärtige Politik und die Zukunft Deutschlands, und er spricht über sehr Persönliches: über prägende Kriegserfahrungen, über eigene Fehler und Versäumnisse, seinen Glauben und das Lebensende.

Helmut Schmidt zieht Bilanz, und Hans-Joachim Noack porträtiert den früheren Bundeskanzler / Von Gregor Schöllgen
Viel hat er geschrieben. Vor allem seit sich der fünfte Kanzler der Republik nach seinem Sturz im Oktober 1982 aus dem politischen Tagesgeschäft zurückgezogen hat, greift Helmut Schmidt regelmäßig zur Feder. Mehr als 20 Bücher hat er seither vorgelegt. Jetzt, wo er 90 wird - gegen "Ende des Lebens", da die meisten Weggefährten "schon endgültig ihre Adresse gewechselt" haben -, wollte er einmal aufschreiben, was er "glaube, im Laufe der Jahrzehnte politisch gelernt zu haben". So ist ein sehr persönliches, zugleich ein sehr politisches Buch entstanden, von dem man wohl sagen darf: Es ist das Vermächtnis des Helmut Schmidt.
Und es ist eine Handreichung für alle, die einmal das Bild dieses Mannes zeichnen werden. Helmut Schmidt weiß, wie er in die Geschichte eingehen will. Zum Beispiel als ein Mann, der "mehr durch Zufall" denn durch Planung zum Berufspolitiker wurde, der aber, einmal dort angekommen, "aus eigenem Willen geblieben" ist. Bislang hat Schmidt, auf sein "Verhältnis zur Macht" angesprochen, stets betont, keines der vielen Ämter angestrebt zu haben - das eines hamburgischen Senators nicht, das eines Verteidigungs- und Finanzministers nicht und das eines Bundeskanzlers auch nicht. Am Abend eines langen Lebens und "nach Lektüre mancher Psychologiebücher" ist er sich da nicht mehr so sicher: "Unbewusst könnte ich diese Ämter vielleicht doch gewollt haben." Allerdings war sein Ehrgeiz nicht auf die Ämter gerichtet, "sondern auf Anerkennung - ähnlich wie ein Künstler oder ein Sportler Anerkennung durch Leistung sucht".
Wer Jahrzehnte in diesem kräftezehrenden Geschäft tätig ist, der macht natürlich auch Fehler. Viele Fehler. Schmidt zählt sie auf. Dass sein Verhältnis zu seiner Partei und zu Willy Brandt im Mittelpunkt dieses Kapitels steht, ist kein Zufall. Denn zu den größten Fehlern des Politikers Schmidt gehört, im Mai 1974 mit der Übernahme des Kanzleramtes "nicht zugleich den Parteivorsitz beansprucht zu haben". So aber konnte er kaum etwas tun, als die "Auflösungserscheinungen an dem sich verbreiternden linken Rand der Sozialdemokratie" zu handfesten politischen Konflikten und diese schließlich über die Frage der Umsetzung des sogenannten Nato-Doppelbeschlusses zur Spaltung der SPD führten.
Brandt, der nach seinem Rücktritt als Kanzler - aus "völlig unzureichendem" Grund, so Schmidt noch heute - die Führung der Partei nicht aus der Hand gab, "förderte" die von Schmidt "kritisierte Entwicklung" eher, als dass er sie hinderte. So kam es zum Ende sozialdemokratischer Regierungsverantwortung und zum Ende einer Freundschaft: "Da standen sich zwei verschiedene politische Naturelle gegenüber, die nicht mehr ins Gespräch miteinander kamen ... Es mag sein, dass die langsame Abkühlung der Freundschaft auf beiderseitigen Fehlern beruhte. Als Brandt 1992 starb, war ich mir jedoch schmerzhaft bewusst, einen Freund verloren zu haben."
Und natürlich war das Verhältnis Schmidts zu seiner Partei ramponiert. Dass auf dem berühmten Kölner Sonderparteitag im November 1983 nur eine Handvoll Genossen für den Doppelbeschluss und damit für das politische Vermächtnis des Exkanzlers stimmten, hat der wohl nie verwunden - auch wenn Helmut Schmidt "tatsächlich ... immer Sozialdemokrat geblieben" ist: "Erst als sich Bundeskanzler Schröder 2003 einer Beteiligung an dem unsäglichen zweiten Irak-Krieg der USA verweigerte und die SPD ihm darin zustimmte ..., habe ich mich wieder in innerer Übereinstimmung mit der Politik der Mehrheit meiner Partei gefunden."
Es sind solche Berichte, eingewoben in ein dichtes Netz von Einsichten, Reflexionen und Maximen, die den Reiz dieses Buches ausmachen. Gewiss ist dem Leser seiner Schriften vieles von dem, was Schmidt zu Protokoll gibt, nicht ganz unbekannt, und nicht selten schrammt der Altbundeskanzler nur haarscharf an banalen oder auch trivialen Feststellungen vorbei. Das gilt für die Thesen, und es gilt für die Lehren, die Schmidt aus seinem Gang durch die Weltgeschichte zieht. Allerdings wird manches durch die biographisch unterlegte, dabei konzentrierte Präsentation deutlicher, als man das bislang bei ihm lesen konnte. So zum Beispiel die gelassene Haltung zu einem wahrscheinlichen "Bedeutungsverlust der Nato", der für die Deutschen "ohne strategische Folgen" bliebe, oder das überraschend klare Bekenntnis zu Europa, das die von Schmidt sonst so gerne zelebrierte Klage über die Brüsseler Bürokratie hinter sich lässt: Weil die Deutschen "stärker als alle anderen Nationen darauf angewiesen" sind, dass "die Union zum Erfolg geführt wird", setzt er seine Hoffnung "auch für morgen auf die fortschreitende Vertiefung der europäischen Integration". Natürlich kommt das Ganze im pädagogischen Duktus daher. Man kennt das von Schmidt, wenn auch im hohen Alter besonders deutlich wird, was immer schon zu beobachten war: An Schmidt ist ein Lehrer verlorengegangen. Das mag damit zu tun haben, dass Gustav Schmidt, Helmuts Vater, diesen Beruf ausgeübt hat. Wahrscheinlicher aber ist, dass die Neigung, den Deutschen immer wieder vor Augen zu führen, was sie "leider nicht" oder wovon sie "nur wenig" wissen, auf den eigenen frühen Nachholbedarf des Mannes zurückgeht.
Denn als der 27 Jahre alte Soldat Helmut Schmidt nach acht Jahren Dienst in der Wehrmacht in einem britischen Gefangenenlager "frustriert seiner verlorenen Jugend" nachgeht, überfällt ihn eine "Gier nach allen erreichbaren Informationen". Der Nachholbedarf des "bildungshungrigen Exoffiziers" ist gewaltig, und so "stürzt er sich in eine Art Studium generale, büffelt Staatslehre, Philosophie und Soziologie und interessiert sich für alles, was ihm die ignoranten Nazis vorenthalten haben". Das kann man jetzt bei Hans-Joachim Noack nachlesen. Der frühere langjährige Mitarbeiter des "Spiegel" kennt Schmidt, seit er mit ihm während der Großen Koalition der Jahre 1966 bis 1969 ein erstes Interview geführt hat. "Die Biographie", die er zum Neunzigsten von Schmidt vorlegt, kündet von einer exzellenten Kenntnis des Mannes und seiner Zeit. Noack zeichnet ein differenziertes Bild mit klaren Konturen, das den Privatmann nicht vergisst, von Sympathie getragen ist, aber nie in hagiographische Überzeichnungen abgleitet.
So lernt man einen von Erfolgen und Triumphen, aber eben auch von Rückschlägen und Niederlagen geprägten Mann kennen, der wie die meisten seiner Generation durch das frühe Kriegserlebnis geformt ist: "Freunde sind nach seinem Empfinden zuallererst ,Kameraden', eine aus dem Schützengraben ins zivile Leben übernommene Analogie". Sie erklärt, warum "Verlässlichkeit und Berechenbarkeit im Wertekanon ... Schmidts obenan" stehen und warum er zum Beispiel dem CSU-Politiker Franz Josef Strauß - einem seiner schärfsten Widersacher, aber wie Schmidt Oberleutnant im Krieg mit ähnlicher Erfahrung - mit größerem Respekt begegnete als manchem prominenten Genossen aus den eigenen Reihen. Gut möglich, dass die Kriegserfahrung auch den erstaunlich souveränen Umgang Schmidts mit dem Machtverlust, aber auch mit der Erkenntnis erklärt, dass "große Kanzler ... große Themen" benötigen. Dabei gilt die von Noack zitierte, "leicht elegische" Erkenntnis Helmut Schmidts, das "Glück eines epochalen Auftrags" sei ihm nie beschieden gewesen, nur bedingt. Wer die Weichen in so elementaren Fragen wie dem Nato-Doppelbeschluss, dem Europäischen Währungssystem oder auch dem Kampf gegen den Terrorismus richtig stellt, ist ein bedeutender Mann - auch wenn er die Früchte seiner Arbeit nicht mehr im Amt geerntet hat.
Helmut Schmidt: Außer Dienst. Eine Bilanz. Siedler Verlag, München 2008. 350 S., 22,95 [Euro].
Hans-Joachim Noack: Helmut Schmidt. Die Biographie. Rowohlt Verlag, Berlin 2008. 317 S., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Persönlich und politisch begegnet Helmut Schmidt dem Rezensenten Gregor Schöllgen in diesem Buch, das Schöllgen schlicht und ergreifend als Schmidts Vermächtnis versteht. Zugleich macht er auf ein Fährnis des Buches aufmerksam, indem er es als Handreichung für künftige Biografen, aber auch als bewusste Weichenstellung des Autors bezüglich seines Bildes in der Galerie der Geschichte bezeichnet. Dass Schmidt dennoch keine Fehler verschweigt (siehe sein Verhältnis zu Willy Brandt), rechnet Schöllgen ihm hoch an. Den Reiz des Buches sieht er allerdings in der "biografisch unterlegten, dabei konzentrierteren" Präsentation durchaus bekannter Fakten. Über die Themen Nato und Europa etwa hat Schöllgen derart deutlich bei Schmidt noch nicht gelesen. Wenn der Autor mitunter den Pädagogen heraushängen lässt oder auch mal weniger Belangvolles erzählt, kann der Rezensent damit leben.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein gutes Buch ohne jede politische Gebetstrommelei.« Der Tagesspiegel
"Das Hörbuch ist eine kluge und beinahe philosophische Betrachtung über die heutige Zeit von einem Staatsmann von Format."