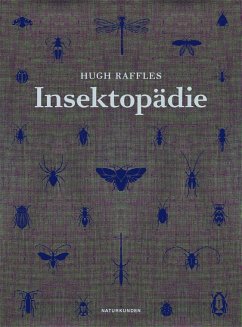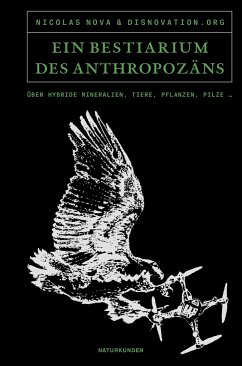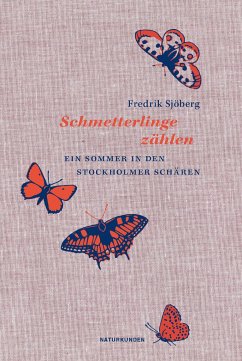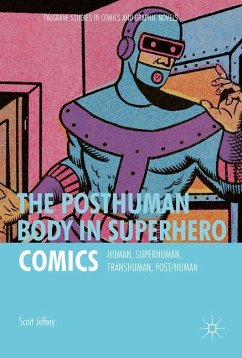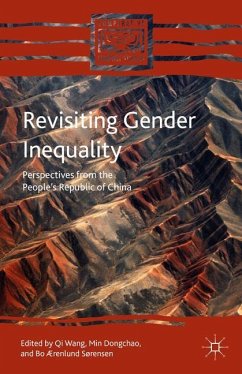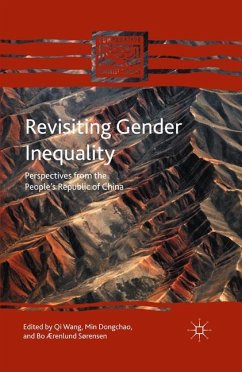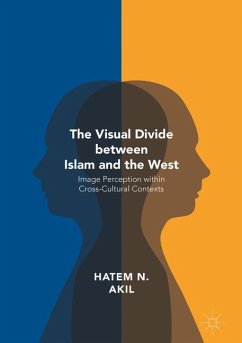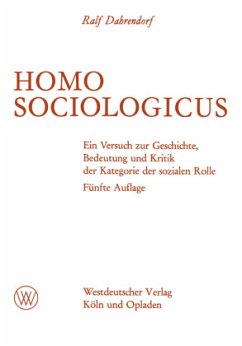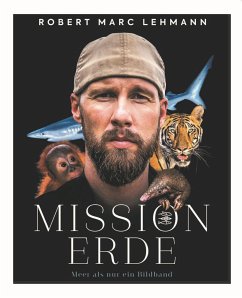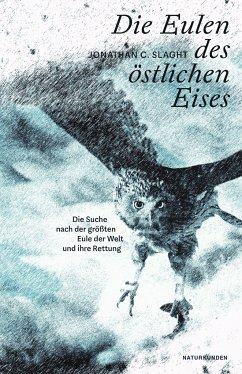Austern
Ein Portrait
Herausgegeben: Schalansky, Judith;Illustration: Nordmann, Falk
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
22,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Sobald der feste Muskel des beim Verzehr noch lebenden Tiers durchtrennt ist, offenbart sich der darin lebende Mollusk: Er hat ein Herz, aber kein Gehirn, dafür Magen, Darm und After. Vielleicht steht die Auster genau deswegen im Zentrum erotischer Fantasien, als Inbegriff der Kreatürlichkeit. Als solcher findet sie im 16. Jahrhundert Eingang in die Malerei, um schließlich im 19. Jahrhundert eine Popularisierung zu erfahren: Bevor die Auster zur Delikatesse wurde, war sie billiges Streetfood, ein Arme-Leute-Essen. Und lange bevor die Queer Theory die Frage nach dem Geschlecht zu verflüssig...
Sobald der feste Muskel des beim Verzehr noch lebenden Tiers durchtrennt ist, offenbart sich der darin lebende Mollusk: Er hat ein Herz, aber kein Gehirn, dafür Magen, Darm und After. Vielleicht steht die Auster genau deswegen im Zentrum erotischer Fantasien, als Inbegriff der Kreatürlichkeit. Als solcher findet sie im 16. Jahrhundert Eingang in die Malerei, um schließlich im 19. Jahrhundert eine Popularisierung zu erfahren: Bevor die Auster zur Delikatesse wurde, war sie billiges Streetfood, ein Arme-Leute-Essen. Und lange bevor die Queer Theory die Frage nach dem Geschlecht zu verflüssigen suchte, war diese unscheinbare Meeresbewohnerin bereits eine Meisterin der gender fluidity: Je nach Witterung wechseln Austern mehrmals im Leben ihr Geschlecht. Auf den Spuren dieses faszinierenden Tiers begibt sich Andreas Ammer auf Fischmärkte, in Hafenlokale und auf Schiffe, um letztendlich doch immer zu diesem einen Moment zurückzukehren: der Oyster Conversion Experience, der lebensverändernden Begegnung mit diesem unsichtbaren Meerestier, dessen Geschmack nach Ozean er immer wieder herbeisehnt. Und zu der Frage, wie sich von einem Tier erzählen lässt, das zwar schon weitaus länger als der Mensch lebt, sich jedoch die allermeiste Zeit zwischen zwei Schalen verbirgt.