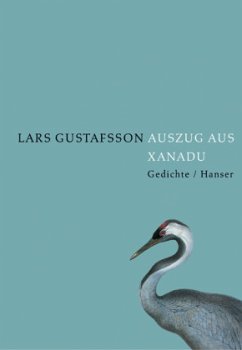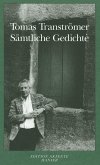Jedes Jahr Ende August pflegte Khubilai Khan von seinem Sommerschloss in Xanadu aufzubrechen. Auf einen Diwan hingestreckt, in einem Haus, das vier Elefanten trugen, ließ er sich nach Peking transportieren. Woran der Khan auf einer solchen Reise dachte? Vielleicht weilte er in Gedanken bei dem verflossenen Sommer. Auch Gustafsson ist in Xanadu gewesen und entführt uns in eine poetische Welt zwischen Gegenwart und Vergangenheit, Wirklichkeit und Reflexion.

Auf leichtem Fuß, mit leisen Sohlen: Lars Gustafssons neue Gedichte atmen die Anmut des Alltags / Von Tobias Döring
Xanadu, später: Das Sommerhaus des großen Khan, steht leer, das Lustschloß ist verlassen, der Herrscher abgereist. Vor knapp zweihundert Jahren überkam den englischen Dichter Samuel Taylor Coleridge, wie er schrieb, eine irre Traumvision von berückend süßer Macht, ein exotisches Phantombild, das er in fiebrig glühende Verse faßte: "In Xanadu did Kubla Khan / A stately pleasure dome decree." Seither gilt der erhabene Luxuskuppelbau jenes Mongolenkaisers am fernen Ort als Sehnsuchtsbild romantischer Erhebung - ein Rausch, der allen grauen Alltag übersteigt. Zugleich jedoch ist dieser Traum immer bedroht wie eine Seifenblase, die schon bei leichtester Berührung mit der Wirklichkeit zerplatzt. Noch der Millennium Dome in London, jenes hybride Lust- und Luftschloß, mit dem New Labour sich einst zur Jahrtausendwende feiern wollte, zeugt gleichermaßen von der Verführung wie der Banalisierung derartig großmächtiger Visionen. Jetzt besichtigt der schwedische Lyriker Lars Gustafsson die Ruinen und erkundet, was von Xanadu übrigblieb.
Einen nüchterneren, skeptischeren Palastarchäologen könnte man kaum finden: "Ich bleibe also hier / in diesen paar Räumen eines allzu großen Palasts, / in denen es mir gelingt / die Zimmer angenehm temperiert zu halten", erklärt er mit wohltuendem Sinn fürs Naheliegende und macht zugleich klar, daß er den Verlockungen des Fremden, Fernen, Üppigen wohl zu widerstehen in der Lage ist: "Was für Orchideen gedeihen dort / in den Beeten, / und welche schnellen Schlangen verbirgt / der grüne Schatten unter den Blättern?" Wir werden es nie erfahren, denn dieser Dichter richtet sich lieber diesseits der künstlichen Paradiese ein. Das Titelgedicht seines neuen Bandes überblendet dazu die phantastischen Traumfragmente der Romantik mit Erinnerungen an einfache Spätsommertage in Schweden, brüchige Bilder aus Kindertagen, deren Alltagsanmut uns bald stärker ergreift als aller Orchideenrausch. Denn in seinen stärksten Momenten gelingt es Gustafsson auf wunderbare Weise, den unbekannten Reiz des Temperierten auszukosten.
Spätsommer allenthalben. "Vorbereitungen für die Wintersaison" (1992) hieß schon ein früherer Gedichtband. Wie dort liegt auch jetzt wieder eine leise Endzeitstimmung über vielen Texten. Sie schwelgen nicht im Pathos des Elegischen, halten nur kurz inne und geben Raum für einen letzten tiefen Atemzug, ehe die Temperatur umschlägt und die Zeit sich ändert: "So geht denn dieser lange Sommer zu Ende. / Mit jedem Jahr werden die Tage kürzer, / die Worte etwas langsamer." Aber wie bei jeder Entschleunigung öffnet auch dieser Augenblick die Sicht auf bislang Unentdecktes. Zur Leitfigur solcher Beobachtung setzt Gustafsson den Falken auf die Fährte des Vergänglichen, "einen Vogel des Herbstes und der Reife", wie es heißt, "einen, der nicht mordet, / sondern mit scharfen Augen / alles beobachtet". So kann ein letzter Blick noch bannen, was zergeht, solange nur die Augen dem beständigen Fluß der Welt folgen.
Lars Gustafsson, Jahrgang 1936 und seit zwei Jahrzehnten an der Universität von Austin, Texas, tätig, ist ein poeta doctus, dessen Werke selbstbewußt und selbstverständlich mit großen Geistern wie Descartes, Schopenhauer oder Frege Zwiesprache halten. Viel eindringlicher aber als solche philosophisch grundierte Gedankenlyrik sind seine Dinggedichte, wenn sie in knappen Worten ganz Konkretes zur Sprache bringen und dabei doch stets ahnen lassen, wie unbeholfen, ja behelfsmäßig das Sprechen ist. So weltzugewandt und weltläufig die Texte sind - ihr geographischer Bogen spannt sich von Altschweden über Moskau, Berlin, Lissabon, Tristan da Cunha bis in die Neue Welt -, so sehr zweifeln sie doch prinzipiell an der Welthaltigkeit von Sprache. Es ehrt die Übersetzer Verena Reichel und Hans Magnus Enzensberger ganz besonders, daß sie noch den scheinbar schlichtesten deutschen Versen einen solchen Nachklang des Tastenden, Skeptischen, Vergleichenden geben: "Und der nackte Fuß geht durchs Gras / und es fühlt sich an wie lange her. / Im seichten Gräserschatten." Was hier mit der klaren Schönheit eines Haiku anhebt, wird doch sogleich vom Möglichkeitssinn heimgesucht.
Vielleicht liegt darin der eigentliche Gegensatz zu Kubla Khan. Jener Herrscher schuf, wie wir bei Coleridge lesen, das monumentale Bauwerk per "decree", per Erlaß, und bot so den Dichterfürsten seinerzeit das Modell für die weltschaffende Macht des Wortes. In "Sprache und Lüge" (1980) dagegen, seinem philosophischen Hauptwerk, bekennt Gustafsson sich zu der Auffassung, daß er, wie viele Dichter der Moderne, das ursprüngliche Vertrauen in Sprache verloren habe. Statt Welt zu erschaffen oder auch nur widerzuspiegeln, bleibt seinen Gedichten die Suche. Der "Auszug aus Xanadu" führt sie nicht in ein gelobtes Land, sondern in die Wüste einer bilderlosen Wirklichkeit, in der die Dinge weder reden noch bedeuten, sondern zuerst und vor allem wahrgenommen werden wollen. Dazu lädt uns dieser Band mit sanftem, doch entschiedenem Nachdruck ein.
Sein schönster Text trägt den Titel "Mit einer Katze im Bett zu schlafen". Dessen unaufdringliche Verführungskraft empfiehlt ihn ausdrücklich auch Hundeliebhabern sowie überhaupt allen Lesern, die ansonsten Lyrik meiden. "Und der Schlaf der Katze ruft in mir / einen tieferen Schlaf hervor /... / gibt mir ein Gefühl der Vertrautheit, / ein Heimatgefühl, / so als wäre die Welt / ein gänzlich natürlicher / Aufenthalt." So einfach ist das: Der Schlaf der Katze schafft Geborgenheit. Mit einem so leichtfüßig bodenständigen Dichter wie Lars Gustafsson als Fährtensucher brauchen wir uns daher nicht in entlegene Phantasien zu flüchten, sondern finden ein nicht weniger lustvolles Zuhause hier und jetzt - und sei es im eigenen Bett.
Lars Gustafsson: "Auszug aus Xanadu". Gedichte. Aus dem Schwedischen übersetzt von Hans Magnus Enzensberger und Verena Reichel. Hanser Verlag, München 2003. 104 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Lars Gustafssons großartige Gedichte über Gott, Schweden, das Universum und den Nachmittag."
Iris Radisch, Die Zeit, 11.12.03
"Dieses Leseglück kann sich ins Lebensglück fortsetzen...Mit diesem Band kann man, wenn alles schläft, einsam wachen in einer schönen stillen Nacht."
Heinrich Detering, Literaturen, 12/03
"Ein ums andere Mal führt der schwedische Autor vor, wie genau er mit seinen freien Versen die Welt abtasten kann, um die fein geschwungenen Gebilde dann hinauf ins Tageslicht zu schicken...in den Gedichten wird das Knistern der Geistesgeschichte ebnso vernehmbar, wie der dumpfe Ton alter Gartenmesser."
Nico Bleutge, Neue Zürcher Zeitung, 10.02.04
Iris Radisch, Die Zeit, 11.12.03
"Dieses Leseglück kann sich ins Lebensglück fortsetzen...Mit diesem Band kann man, wenn alles schläft, einsam wachen in einer schönen stillen Nacht."
Heinrich Detering, Literaturen, 12/03
"Ein ums andere Mal führt der schwedische Autor vor, wie genau er mit seinen freien Versen die Welt abtasten kann, um die fein geschwungenen Gebilde dann hinauf ins Tageslicht zu schicken...in den Gedichten wird das Knistern der Geistesgeschichte ebnso vernehmbar, wie der dumpfe Ton alter Gartenmesser."
Nico Bleutge, Neue Zürcher Zeitung, 10.02.04
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Rezensent Tobias Döring sieht die stärksten Gedichte dieses Lyrikbandes auf wunderbare Weise den "Reiz des Temperierten" auskosten und fühlt sich von ihrer "Alltagsanmut" stärker ergriffen als von allem "Orchideenrausch" üblicher Lyrik. Auch über den neuen Gedichten des schwedischen Dichters Lars Gustafsson sieht er wieder eine leise Endzeitstimmung liegen. Ihren geografischen Bogen spannen sie, lesen wir, von Altschweden über Moskau, Berlin, Lissabon ... bis in die Neue Welt. So weltzugewandt die Texte jedoch sind, so sehr sieht Döring sie prinzipiell an der "Welthaftigkeit von Sprache" zweifeln. Die Übersetzer Verena Reichel und Hans Magnus Enzensberger lobt er, weil sie noch den scheinbar schlichtesten Versen im Deutschen einen "Nachklang des Tastenden, Skeptischen, Vergleichenden" gegeben haben. Am eindrucksvollsten findet der Rezensent Gustafssons "Dinggedichte": weil sie "in knappen Worten ganz Konkretes zur Sprache bringen" und dabei doch stets ahnen lassen, "wie unbeholfen, ja behelfsmäßig das Sprechen" ist.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"