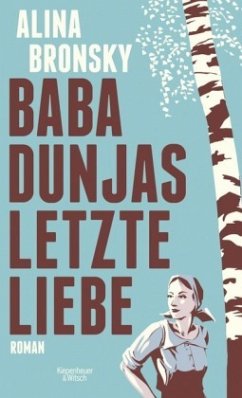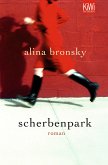Baba Dunja ist eine Tschernobyl-Heimkehrerin. Wo der Rest der Welt nach dem Reaktorunglück die tickenden Geigerzähler und die strahlenden Waldfrüchte fürchtet, baut sich die ehemalige Krankenschwester mit Gleichgesinnten ein neues Leben auf. Wasser gibt es aus dem Brunnen, Elektrizität an guten Tagen und Gemüse aus dem eigenen Garten. Die Vögel rufen im Niemandsland so laut wie nirgends sonst, die Spinnen weben verrückte Netze, und manchmal kommt sogar ein Toter auf einen Plausch vorbei. Während der sterbenskranke Petrov in der Hängematte Liebesgedichte liest, die Gavrilovs im Garten Schach spielen und die Melkerin Marja mit dem fast hundertjährigen Sidorow anbandelt, schreibt Baba Dunja Briefe an ihre Tochter Irina, die Chirurgin bei der deutschen Bundeswehr ist. Und an ihre Enkelin Laura. Doch dann kommen Fremde ins Dorf - und die Gemeinschaft steht erneut vor der Auflösung. Alina Bronsky lässt in ihrem neuen Roman eine untergegangene Welt wieder auferstehen. Komisch, klug und herzzerreißend erzählt sie die Geschichte eines Dorfes, das es nicht mehr geben soll - und einer außergewöhnlichen Frau, die im hohen Alter ihr selbstbestimmtes Paradies findet. Auf kleinem Raum gelingt ihr eine märchenhafte und zugleich fesselnd gegenwärtige Geschichte.
Die strahlende Idylle, in die uns Alina Bronsky in „Baba Dunjas letzte Liebe“ entführt, strahlt wirklich. Radioaktiv. Es ist das Dorf Tschernowo in der sogenannten Todeszone von Tschernobyl. Eigentlich ein verlassenes Dorf, denn niemand darf hier leben. Doch Baba Dunja lebt hier – und das ziemlich fidel und in bester Stimmung. Was soll ihr, mit ihren über 90 Jahren, die Strahlung schon anhaben? Sterben wird sie so oder so. Und so kehrte Baba Dunja zurück in ihre Heimat aus der sie wie alle anderen 1986 weggegangen war. Zurück in ihr altes Haus.
Geisterhähne und Tote, die mit im Dorf „leben“ – für Baba Dunja normal
Mit ihr leben noch ein paar Alte wie die Nachbarin Marja oder der über hundertjährige Sidorow im Dorf. Auch der krebskranke Petrow und das Ehepaar Gavrilow und, nicht zu vergessen, Hahn Konstantin, der Baba Dunja mit seinem Gekrähe um den Schlaf bringt. Nun spendet Konstantin als Suppenhuhn einer goldgelb-fetten Brühe Geschmack und Energie – seinen Geist aber sieht Baba Dunja immer noch auf dem Zaun sitzen. Genauso wie den Geist ihres verstorbenen Gatten Jegor, mit dem sie ab und an einen Plausch hält. Ja, es gibt noch viel mehr Tote, die hier mit im Dorf „leben“, sich zeigen – und sie sind auch ziemlich neugierig …
Vom Leben in der Todeszone und Spinnen, die besondere Netze weben …
Baba Dunja lebt von den Hühnern und den Früchten und Gemüsen aus ihrem Garten, einem prächtigen Garten mit fruchtbarer Erde. Alles wächst bestens, auch die Insekten vermehren sich besonders gut, weil die Vögel nicht so widerstandsfähig gegen Strahlung sind wie die Katzen. Und die Spinnen, die vielen Spinnen, weben ihre Netze hier nicht so wie anderswo. Forscher interessieren sich dafür, und immer wieder kommen Wissenschaftler ins Dorf und schauen, wie es den Alten so geht, nehmen ihnen Blut ab und messen die Radioaktivität. Gastfreundlich, wie Baba Dunja ist, bot sie ihnen anfangs etwas an. Eingelegte Pilze oder Tomaten, die Pilzscheiben wanderten aber nicht in den Mund, sondern in ein Plastikglas, und die Tomaten fassten die Forscher mit Gummihandschuhen an. Nun bietet Baba Dunja ihnen nichts mehr an.
Irina, so heißt Baba Dunjas Tochter. Sie schickt regelmäßig ein Paket für ihre Mutter, voll mit Medizin, Räucherwürsten und Konserven und allerhand Nützlichem wie Wäsche, Zahnbürsten oder Streichhölzern. Laura, ihre Enkeltochter, hat Baba Dunja noch nie gesehen. Irina und Laura leben in Deutschland, Irina hat als Chirurgin Karriere gemacht. Auch Baba Dunja kennt sich aus mit Medizin, sie war medizinische Hilfsschwester.
„Ich bin ein Mann. Du bist eine Frau. Lass uns heiraten, Dunja.“
Die Welt, von der Bronsky hier so bildgewaltig erzählt, verzaubert. Vor allem Hauptfigur Baba Dunja, der der über hundertjährige Sidorow aus heiterem Himmel einen Heiratsantrag macht mit den lapidaren Worten: „Du bist eine Frau. Ich bin ein Mann. Lass uns heiraten, Dunja.“ Baba Dunja verschlägt es erstmal die Sprache, doch dann spricht sie ein klares „Nein“.
„Ich kann mir genau vorstellen, was ihn auf Hochzeitsgedanken bringt. Er ist ein Mann und wäscht seine Sachen, wenn sie vor Schmutz steif sind, in einer Schüssel mit Haushaltsseife, um sie dann unausgespült im Garten zum Trocknen aufzuhängen. Zum Essen weicht er sich Haferflocken ein […] Sein Gemüse verfault, weil er zwar einen grünen Daumen hat, aber nicht kochen kann. Ich dagegen koche immer frisch und mein Garten gedeiht.“
Ja, Baba Dunja macht keiner mehr etwas vor. Und so geht Sidorow schließlich zur deutlich jüngeren Marja – und es soll Hochzeit gefeiert werden. Zuvor muss sich der Alte aber noch als Handwerker bewähren und schafft es – wie, weiß keiner –, ein Bett für Marja zu bauen. Ihres ist zusammengekracht. Ohne Baba Dunja wäre das Dorf nicht, es hätte keine Seele. Das wissen alle hier. Und wenn die heimliche Bürgermeisterin sich auf den Weg in die Stadt macht, um Post zu holen, die Rente abzuheben (den Banken kann man schließlich nicht trauen) und ein paar Lebensmittel wie Salz einzukaufen, dann ist Marja sehr froh, wenn Baba Dunja wieder im Dorf ankommt: „Jedes Mal, wenn du nach Malyschi gehst, hab ich solche Angst, dass du nie mehr zurückkommst.“
„Wir spielen den Tag nach, wie Kinder das Leben nachspielen.“
Doch Baba Dunja kommt zurück. Sie ist hier zu Hause und freut sich zum Beispiel, dass sie beim Gießen der Tomaten und Gurken in den Abendstunden wieder Bienen entdeckt. Und sie freut sich über die „Sache mit der Zeit“ …
„Was ich in Tschernowo niemals gegen fließend Wasser und eine Telefonleitung eintauschen würde, ist die Sache mit der Zeit. Bei uns gibt es keine Zeit. Es gibt keine Fristen und keine Termine. Im Grunde sind unsere täglichen Abläufe eine Art Spiel. Wir stellen nach, was Menschen normalerweise tun. Wir müssen weder morgens aufstehen noch abends ins Bett gehen. Wir könnten es auch genau umgekehrt machen. Wir spielen den Tag nach, wie Kinder mit Puppen und Kaufmannsladen das Leben nachspielen.
Zwischendrin vergessen wir, dass es noch die andere Welt gibt, in der die Uhren schneller gehen und wo alle schreckliche Angst vor dieser Erde haben, die uns ernährt. Diese Angst sitzt tief in den anderen Menschen, und die Begegnung mit uns bringt sie an die Oberfläche.“
Als eines Tages ein Mann mit seiner Tochter ins Dorf kommt, gehen alle zuerst davon aus, dass das Mädchen krank ist. Denn mit einem gesunden Kind darf man hier nicht leben. Doch Baba Dunja ist der Kerl nicht geheuer und ihr toter Mann weiß, warum Dunja damit Recht hat. Ein Unglück geschieht, und als die Welt draußen ins Dorf kommt, fangen die Probleme an. Auch für Baba Dunja …
Strahlende Idylle
Die strahlende Idylle, in die uns Alina Bronsky in „Baba Dunjas letzte Liebe“ entführt, strahlt wirklich. Radioaktiv. Es ist das Dorf Tschernowo in der sogenannten Todeszone von Tschernobyl. Eigentlich ein verlassenes Dorf, denn niemand darf hier leben. Doch Baba Dunja lebt hier – und das ziemlich fidel und in bester Stimmung. Was soll ihr, mit ihren über 90 Jahren, die Strahlung schon anhaben? Sterben wird sie so oder so. Und so kehrte Baba Dunja zurück in ihre Heimat aus der sie wie alle anderen 1986 weggegangen war. Zurück in ihr altes Haus.
Geisterhähne und Tote, die mit im Dorf „leben“ – für Baba Dunja normal
Mit ihr leben noch ein paar Alte wie die Nachbarin Marja oder der über hundertjährige Sidorow im Dorf. Auch der krebskranke Petrow und das Ehepaar Gavrilow und, nicht zu vergessen, Hahn Konstantin, der Baba Dunja mit seinem Gekrähe um den Schlaf bringt. Nun spendet Konstantin als Suppenhuhn einer goldgelb-fetten Brühe Geschmack und Energie – seinen Geist aber sieht Baba Dunja immer noch auf dem Zaun sitzen. Genauso wie den Geist ihres verstorbenen Gatten Jegor, mit dem sie ab und an einen Plausch hält. Ja, es gibt noch viel mehr Tote, die hier mit im Dorf „leben“, sich zeigen – und sie sind auch ziemlich neugierig …
Vom Leben in der Todeszone und Spinnen, die besondere Netze weben …
Baba Dunja lebt von den Hühnern und den Früchten und Gemüsen aus ihrem Garten, einem prächtigen Garten mit fruchtbarer Erde. Alles wächst bestens, auch die Insekten vermehren sich besonders gut, weil die Vögel nicht so widerstandsfähig gegen Strahlung sind wie die Katzen. Und die Spinnen, die vielen Spinnen, weben ihre Netze hier nicht so wie anderswo. Forscher interessieren sich dafür, und immer wieder kommen Wissenschaftler ins Dorf und schauen, wie es den Alten so geht, nehmen ihnen Blut ab und messen die Radioaktivität. Gastfreundlich, wie Baba Dunja ist, bot sie ihnen anfangs etwas an. Eingelegte Pilze oder Tomaten, die Pilzscheiben wanderten aber nicht in den Mund, sondern in ein Plastikglas, und die Tomaten fassten die Forscher mit Gummihandschuhen an. Nun bietet Baba Dunja ihnen nichts mehr an.
Irina, so heißt Baba Dunjas Tochter. Sie schickt regelmäßig ein Paket für ihre Mutter, voll mit Medizin, Räucherwürsten und Konserven und allerhand Nützlichem wie Wäsche, Zahnbürsten oder Streichhölzern. Laura, ihre Enkeltochter, hat Baba Dunja noch nie gesehen. Irina und Laura leben in Deutschland, Irina hat als Chirurgin Karriere gemacht. Auch Baba Dunja kennt sich aus mit Medizin, sie war medizinische Hilfsschwester.
„Ich bin ein Mann. Du bist eine Frau. Lass uns heiraten, Dunja.“
Die Welt, von der Bronsky hier so bildgewaltig erzählt, verzaubert. Vor allem Hauptfigur Baba Dunja, der der über hundertjährige Sidorow aus heiterem Himmel einen Heiratsantrag macht mit den lapidaren Worten: „Du bist eine Frau. Ich bin ein Mann. Lass uns heiraten, Dunja.“ Baba Dunja verschlägt es erstmal die Sprache, doch dann spricht sie ein klares „Nein“.
„Ich kann mir genau vorstellen, was ihn auf Hochzeitsgedanken bringt. Er ist ein Mann und wäscht seine Sachen, wenn sie vor Schmutz steif sind, in einer Schüssel mit Haushaltsseife, um sie dann unausgespült im Garten zum Trocknen aufzuhängen. Zum Essen weicht er sich Haferflocken ein […] Sein Gemüse verfault, weil er zwar einen grünen Daumen hat, aber nicht kochen kann. Ich dagegen koche immer frisch und mein Garten gedeiht.“
Ja, Baba Dunja macht keiner mehr etwas vor. Und so geht Sidorow schließlich zur deutlich jüngeren Marja – und es soll Hochzeit gefeiert werden. Zuvor muss sich der Alte aber noch als Handwerker bewähren und schafft es – wie, weiß keiner –, ein Bett für Marja zu bauen. Ihres ist zusammengekracht. Ohne Baba Dunja wäre das Dorf nicht, es hätte keine Seele. Das wissen alle hier. Und wenn die heimliche Bürgermeisterin sich auf den Weg in die Stadt macht, um Post zu holen, die Rente abzuheben (den Banken kann man schließlich nicht trauen) und ein paar Lebensmittel wie Salz einzukaufen, dann ist Marja sehr froh, wenn Baba Dunja wieder im Dorf ankommt: „Jedes Mal, wenn du nach Malyschi gehst, hab ich solche Angst, dass du nie mehr zurückkommst.“
„Wir spielen den Tag nach, wie Kinder das Leben nachspielen.“
Doch Baba Dunja kommt zurück. Sie ist hier zu Hause und freut sich zum Beispiel, dass sie beim Gießen der Tomaten und Gurken in den Abendstunden wieder Bienen entdeckt. Und sie freut sich über die „Sache mit der Zeit“ …
„Was ich in Tschernowo niemals gegen fließend Wasser und eine Telefonleitung eintauschen würde, ist die Sache mit der Zeit. Bei uns gibt es keine Zeit. Es gibt keine Fristen und keine Termine. Im Grunde sind unsere täglichen Abläufe eine Art Spiel. Wir stellen nach, was Menschen normalerweise tun. Wir müssen weder morgens aufstehen noch abends ins Bett gehen. Wir könnten es auch genau umgekehrt machen. Wir spielen den Tag nach, wie Kinder mit Puppen und Kaufmannsladen das Leben nachspielen.
Zwischendrin vergessen wir, dass es noch die andere Welt gibt, in der die Uhren schneller gehen und wo alle schreckliche Angst vor dieser Erde haben, die uns ernährt. Diese Angst sitzt tief in den anderen Menschen, und die Begegnung mit uns bringt sie an die Oberfläche.“
Als eines Tages ein Mann mit seiner Tochter ins Dorf kommt, gehen alle zuerst davon aus, dass das Mädchen krank ist. Denn mit einem gesunden Kind darf man hier nicht leben. Doch Baba Dunja ist der Kerl nicht geheuer und ihr toter Mann weiß, warum Dunja damit Recht hat. Ein Unglück geschieht, und als die Welt draußen ins Dorf kommt, fangen die Probleme an. Auch für Baba Dunja …
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensentin Sabine Berking zeigt sich enttäuscht von Alina Bronskys neuem Roman. Wo sind nur die kanonenschnelle Sprache, die Präzision, die Ironie hin, die Berking aus Bronskys Romandebüt kennt? In der Todeszone von Tschnernobyl, dem Setting des neuen Romans, wo einige resolute Alte ausharren, Gemüse ziehen, ihre Füße betrachten und einen Mord vertuschen jedenfalls nicht, versichert Berking. Das Buch lässt sie erst lange auf eine Handlung warten und nervt die Rezensentin dann mit viel Redseligkeit, wenig Geschehen, einem austauschbaren Handlungsort und einer Slapstick-Nummer nach der nächsten. Auf Berking wirkt das schal und leblos.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Der zweite Abend von "Literatur im Römer"
Oskar geht betteln: auf der Gucci-Straße. Die Zürcher Bahnhofstraße mit ihren Luxusläden sei der richtige Ort, um seine Impulskontrolle zu überprüfen, meint sein Psychotherapeut. Eigentlich nicht seiner, sondern der von Viktor. Denn der beste Freund hat ein Eheproblem, aber keine Zeit für die Therapie. Deshalb soll Oskar ihn vertreten. So geht es an der Goldküste des Zürichsees zu, wo der Schweizer Schriftsteller Philipp Tingler logiert. Jetzt hat sich der offenbar gutbetuchte Autor in den sozialen Brennpunkt Frankfurt begeben, um sein Buch über "Schöne Seelen" (Kein & Aber) vorzustellen. Im Gespräch mit Alf Mentzer vom Hessischen Rundfunk amüsierte er das Publikum am zweiten Abend von "Literatur im Römer", der Veranstaltung, mit der die Stadt traditionell ihre Bürger zur Buchmesse beglückt. Tingler präsentiert ein Völkchen, das mit gelifteten Seelen sein Unglück auf hohem Niveau bejammert.
In Zürich ist alles besser: zum Beispiel das Licht zum Lesen. Jedenfalls musste sich der Autor ziemlich verrenken, ehe er sein eigenes Buch entziffern konnte. Auch mancher Gast in der VIP-Loge rutschte ungeduldig hin und her, weil es von hinten jedes Mal eisig hereinzog, wenn sich das Tor zu den Römerhallen öffnete und schloss. Aber das Kommen und Gehen ist typisch für den Leseabend mit acht Autoren im Viertelstundenrhythmus, den Mentzers Kollegin Cécile Schortmann regelmäßig überzog - zum Bedauern all derer, die ihre Rückenmuskeln auf den lehnenlosen Bierzeltbänken schmerzhaft spürten. Dabei konnte noch froh sein, wer rechtzeitig einen Sitzplatz ergattert hatte. Viele Besucher, wenn auch nicht mehr so viele wie am ersten Abend, standen sich auch in diesem Jahr die Beine in den Bauch - sogar die schon etwas betagteren. Das ist immer wieder bewundernswert.
Immerhin: Der zweite Abend war kurzweiliger als der erste. Das war neben Tingler vor allem Alina Bronsky zu verdanken. Nach einer peinlichen Selbstdarstellung Friedrich Anis mit seinem Groschenroman "Der namenlose Tag" (Suhrkamp) hievten Katharina Hacker und Feridun Zaimoglu die Veranstaltung auf seriöseres Niveau. Die deutsche Schriftstellerin mit dem Faible für Israel hat ein Buch über einen Mann verfasst, dessen Gespür für Sterbende ihn stets an den rechten Ort führt, um Beistand zu leisten, ob Mensch oder Tier. "Skip" (S. Fischer), der, wie sein Name sagt, manches überspringt, erinnert an den biblischen Bileam, der von seiner hellsichtigen Eselin geadelt wird. Zaimoglus poetisch dichter Achthundertseitenroman über das "Siebentürmeviertel" (Kiepenheuer & Witsch) von Istanbul lässt zwischen 1939 und 1949 archaische Mythen durch ein deutsches Flüchtlingskind raunen.
Aufatmen nach dieser gewöhnungsbedürftigen Rhapsodie samt kleinem Werwolf. Alina Bronsky erzählt in ihrem Roman "Baba Dunjas letzte Liebe" (Kiepenheuer & Witsch) von einer Ukrainerin, die auf ihre alten Tage nach Tschernobyl zurückkehrt. Dass die Tomaten verstrahlt sind, kümmert sie nicht, Hauptsache, der aufdringliche Hahn der Nachbarin landet im Kochtopf. Woher die junge russische Autorin die Erfahrungsweisheit, die Gelassenheit und den selbstkritisch trockenen Witz ihrer Ich-Erzählerin nimmt, bleibt ihr Geheimnis, aber sie gibt zu: "So eine Oma hätte ich gern gehabt."
Als Matthias Nawrat "Die vielen Tode des Opa Jurek" (Rowohlt) zur Hand nahm, war der Brezelkorb der Zuhörer leer. Konstantin, der gesottene Hahn, hatte offenbar den Appetit angeregt, nun aber stand "Todeshunger" an. Der deutsche Autor polnischer Herkunft hat seinem Großvater genau zugehört, und der hat ihm von Auschwitz erzählt. Nach solch schwerer Kost lieferte die Literaturkritikerin Ursula März einen albernen Kontrast. In ihrem Buch "Für eine Nacht oder fürs ganze Leben" (Hanser) erzählt sie von Leuten, die im Internet nach Partnern suchen - ein schwacher Abgesang.
CLAUDIA SCHÜLKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Eine große Geschichte von Menschen und ihrem Mut, ihrer Kraft und ihrer Unbeugsamkeit (...) Am Ende des Romans, nach 154 Seiten, hätte ich das Buch am liebsten umarmt.« Christine Westermann WDR Frau TV