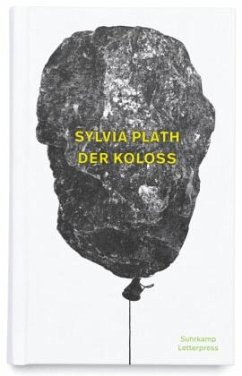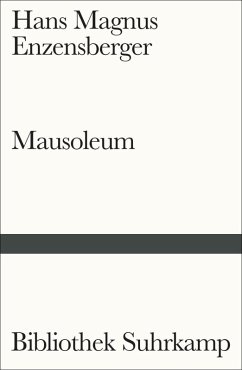Babyn Jar. Stimmen
Gedichte. Ukrainisch und deutsch Eines der wichtigsten Bücher der ukrainischen Gegenwartsliteratur
Übersetzung: Dathe, Claudia

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In Babyn Jar, einer Schlucht bei Kiew, wurden Ende September 1941 mehr als 33 000 Kiewer Juden von den deutschen Einsatzgruppen, der Wehrmacht und lokalen Helfern erschossen. Das Hier und Jetzt jener endlosen Tage verwandelt die ukrainische Lyrikerin Marianna Kijanowska in eine nicht mehr weichende Gegenwart. Die 67 Gedichte ihres Zyklus, die »Stimmen«, sind fiktive Selbstaussagen von Kiewer Bürgern, die durch die Straßen getrieben wurden, aber auch von anderen, die am Fenster standen oder von ferne die Schüsse hörten.Das Buch ist in vieler Hinsicht einzigartig und wird Anlass zu Diskuss...
In Babyn Jar, einer Schlucht bei Kiew, wurden Ende September 1941 mehr als 33 000 Kiewer Juden von den deutschen Einsatzgruppen, der Wehrmacht und lokalen Helfern erschossen. Das Hier und Jetzt jener endlosen Tage verwandelt die ukrainische Lyrikerin Marianna Kijanowska in eine nicht mehr weichende Gegenwart. Die 67 Gedichte ihres Zyklus, die »Stimmen«, sind fiktive Selbstaussagen von Kiewer Bürgern, die durch die Straßen getrieben wurden, aber auch von anderen, die am Fenster standen oder von ferne die Schüsse hörten.
Das Buch ist in vieler Hinsicht einzigartig und wird Anlass zu Diskussionen geben. Der wohl bedeutsamste Aspekt: eine nicht-jüdische Ukrainerin klagt und erinnert an die Kiewer Juden, deren Ermordung erst nach und nach den Platz in der Erinnerungskultur der heutigen Ukraine einnimmt. Ihr Gedichtzyklus ist ein Monument aus Stimmen - visionär und verfremdend zugleich.
Das Buch ist in vieler Hinsicht einzigartig und wird Anlass zu Diskussionen geben. Der wohl bedeutsamste Aspekt: eine nicht-jüdische Ukrainerin klagt und erinnert an die Kiewer Juden, deren Ermordung erst nach und nach den Platz in der Erinnerungskultur der heutigen Ukraine einnimmt. Ihr Gedichtzyklus ist ein Monument aus Stimmen - visionär und verfremdend zugleich.