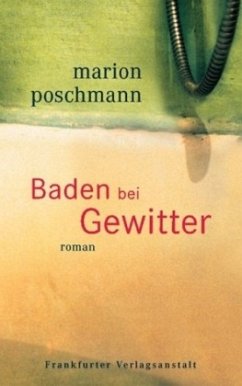Peter ist dünn und sehr nervös, ein Sonderling ohne Zweifel. Und etwas hat die junge Frau für ihn eingenommen, obwohl die beiden auf der Alltagsebene wirklich nicht zusammenpassen. Vielleicht ist es sein besonderer Humor oder die Hartnäckigkeit, mit der er ihr gleich zu Anfang der Geschichte, als beide als Patienten in einem Krankenhaus aufeinandertreffen, ein Gespräch aufzwingt. Sie lernt seine zwischen Ordnung und Chaos schwebende Wohnung, seine sonderbaren Lebensumstände kennen. Beide teilen das Gefühl einer existentiellen Bodenlosigkeit, einer scheiternden Normalität, der merkwürdigen Fragilität des eigenen Ichs. Eine ebenso einmalige wie verstörende Beziehung entwickelt sich.»Baden bei Gewitter« ist ein intelligenter und mutiger Roman, der mit hoher sprachlicher Sensibilität einiges wagt, ohne sich an bekannte literarische Moden zu verkaufen. Marion Poschmann besticht durch ihre exzellente Darstellungsgenauigkeit. Sanfte und schöne Beschreibungen wechseln ab mit leidenschaftslos-exakten Bestandsaufnahmen aus dem Archiv Berliner Normalität.

Physik der Gefühle: Marion Poschmanns Romandebüt erzählt die schönste Liebesgeschichte seit langem
Jeder kennt solche Menschen. Oder kennt sie vielmehr nicht, sieht sie nur gelegentlich, weicht ihnen möglichst aus, bei der Begegnung im Treppenhaus, an der Tramhaltestelle oder an der Supermarktkasse, wo sie, auffällig um Unauffälligkeit bemüht, von einem Bein aufs andere treten, mit gedämpfter Stimme vor sich her reden, sich in die Normalität einfügen wollen und doch irgendwann dem Widerstand der Welt, der Tücke des Objekts unterliegen und ihrem gescheiterten Ringen lautstark Ausdruck verleihen.
Auch jener Peter Fischer, dem die junge Ich-Erzählerin in Marion Poschmanns Debütroman während eines Krankenhausaufenthalts begegnet, ist so eine traurige Gestalt, der man bestenfalls im Mondschein, keinesfalls aber bei Tageslicht begegnen will: ein notorischer Jogginganzugträger und hypochondrischer Schokoladenvertilger, eine Nervensäge und ein Sonderling, der in seiner düsteren und miefigen Wohnung Gartenzwerge sammelt und Sozialkontakte ebensowenig wie seinen Körper pflegt. Seine larmoyante Litanei fällt auf die Nerven, sein Äußeres, seine Eß- und Angewohnheiten lösen Ekel aus. Warum die Erzählerin überhaupt auf sein linkisches Angebot zu einem Wiedersehen eingeht, bleibt lange ungewiß. Auch der Leser mag sich fragen, warum diese Randexistenz plötzlich im Mittelpunkt eines Romans stehen soll. Doch je näher sich die beiden kommen, um so stärker gerät auch er in einen Pendel von Abstoßung und Zuneigung, Aggression und Einfühlung. Und siehe da: Dieser Roman, der von nichts anderem erzählt als vom schwierigen, langsamen, heiklen Kennenlernen zweier Menschen, in dem von Handlung nicht im aktiven Sinne, sondern nur als einem passiven Erleiden die Rede sein kann, dieser Roman ist eine der schönsten, zärtlichsten Liebesgeschichten, die zuletzt in deutscher Sprache zu lesen waren. "Baden bei Gewitter" berührt - wie seine Hauptfigur - manchmal peinlich, manchmal merkwürdig, doch läßt nie kalt.
Daß es der Name des Fremden ist, der die Frau elektrisiert, weil es der des Vaters ist, den sie nie gekannt hat, erfährt man ganz beiläufig. Daß sie rechnet, vergleicht, Beweise sucht, wird nie deutlich ausgesprochen. Bis zum Schluß bleibt in der Schwebe, ob die Vaterfigur nicht reines Wunschdenken ist. Vielleicht ist es auch nur die Ähnlichkeit der Traumata, die sie an Fischer bindet, dessen Mutter kurz nach seiner Geburt tot vor dem Gasherd gefunden wurde. "Es überrascht nicht, daß er einen Lebenslauf vorzuweisen hat, der einiges erklärt", räsoniert die Erzählerin einmal, ohne sich selbst restlos erklären zu können.
"Studien in Normalität" ist ein Kapitel überschrieben. Man würde zu kurz greifen, wenn man diesen Roman nur als Psychogramm eines tragischen Falls begreifen würde oder gar als Sozialreport vom Seitenstreifen unserer mehrspurigen Modernisierungsautobahn. Viel interessanter ist das Ich, von dem hier die Rede ist. Wie die dreiste Nachbarin ihre Parterrewohnung Stück für Stück nach draußen verlegt, so scheinen seine Grenzen wie durchlässige Membranen, die unnützen Dinge nach außen gekehrter Teil des unaufgeräumten, chaotischen Innen. Konsequenterweise findet die Intimität ihre Ersatzhandlungen im häuslichen Bereich, beim Geschirrspülen, Kaffeekochen, Putzen, was Fischer zugleich genießt und irritiert, weil es seine bizarren Alltagsrituale durcheinanderbringt.
Obwohl manchmal für ihn "schon die Berührung mit der eigenen Wäsche zuviel Körperkontakt erfordert" und er panisch Distanz wahrt, nimmt er die junge Frau andererseits in Beschlag, umgarnt sie mit seinem Charme aus besseren Tagen und nagelt sie mit seinen Monologen über Gott und Welt fest. Sie dagegen läßt sich hineinziehen in den Bannkreis einer bis zur völligen Bewegungsunfähigkeit reichenden Melancholie, in der sie sich bis zur Selbstaufgabe solidarisch fühlt mit den Außenseitern in ihren Schneckenhäusern und löchrigen "Nervenkostümen". Die unerklärte Liebe ist auch eine gefährliche Regression, eine Rückkehr in eine Symbiose, die die überlebensnotwendigen Grenzen zur Welt noch nicht gezogen hat.
Nicht nur in ihrem psychologischen Strukturalismus knüpft die 1969 geborene Autorin da an, wo der nouveau roman der fünfziger Jahre glaubte, unhintergehbare Standards beschreibender Prosasprache aufgestellt zu haben. Robbe-Grillet, Butor oder auch Toussaint sind Ahnherren dieses Verfahrens, das die Dinge nicht metaphorisch belebt, sondern die Figuren in konkrete räumlichen Konstellationen einbettet und über die Genauigkeit der Beschreibung ihr Innenleben objektiviert. Auch die Dynamik der Beziehung scheint einer physikalischen Gesetzmäßigkeit zu folgen, die freilich nichts vom Zwang des Erotischen an sich hat, eher der Gravitation umeinander kreisender Himmelskörper, der stets eine starke Zentrifugalkraft entgegenwirkt.
Der Spannungsbogen, der sich, der Metapher des Titels gemäß, atmosphärisch aufbaut und sich schließlich fast beiläufig entlädt, wird immer wieder durch retardierende Einschübe, Kindheitserinnerungen, Reflexionen gedehnt. So erzeugt Poschmann mit großer Kunstfertigkeit eine Dichte, in der jedes Motiv eine Vielzahl korrespondierender Spiegelungen kennt: "Elektrische Leitungen, mit denen die Zimmer aller Etagen verknüpft sind. Stromnetze. Spannungen. Tabus: schwer zu entscheiden, wo die eigenen Räume enden." Auch die Lektüre dieses wunderlichen, wunderbaren Romans ist mit der letzten Seite nicht beendet.
Marion Poschmann: "Baden bei Gewitter". Roman. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 2002. 304 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Als eine der schönsten Liebesgeschichten in der jüngeren deutschen Literatur feiert Rezensent Richard Kämmerlings diesen "wunderlichen, wunderbaren" Debütroman. Er berühre wie seine Hauptfigur Peter Fischer, fährt Kämmerlings fort: "manchmal peinlich, manchmal merkwürdig", doch er lasse nie kalt. Eine isolierte und schrullige Figur sei dieser Jogginganzug tragende und permanent Schokolade essende Fischer, dessen kompliziert beginnende Beziehung zu einer jungen Frau der Roman beschreibt. Der Rezensent lobt die 1969 geborene Autorin in allerhöchsten Tönen, und sieht sie neben Robbe-Grillet und Toussaint stehen. Marion Poschmanns psychologischer Strukturalismus knüpfe da an, wo der "nouveau roman" der fünfziger Jahre geglaubt habe, endgültige Standards für Prosa aufgestellt zu haben, meint Kämmerlings, dem dieser Roman lange im Gedächtnis bleiben wird.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH