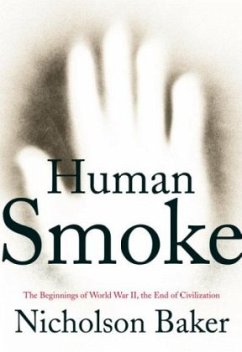A persuasive argument for peace and pacifism, this critical study of the decades leading up to World War II offers insightful profiles of the world leaders, politicians, business people, bankers, and others whose personal politics, ideologies, and agendas provided an inevitable barrier to the peace process and whose actions led to the outbreak of war.

Eine Collage von Stimmen als literarisches Ereignis: Nicholson Baker glaubt nicht an Bomberpiloten als Helden und lässt den Zweiten Weltkrieg aus leisen Vorzeichen entstehen.
Von Lorenz Jäger
Die Hoffnung der Juden, die sich an den Zweiten Weltkrieg heftet, ist armselig." Max Horkheimer, Leiter des exilierten Frankfurter Instituts für Sozialforschung, schrieb diesen Satz in den ersten Septembertagen 1939 nieder. Merkwürdig ist er aus mehreren Gründen und wohl nicht zuletzt deshalb, weil damals eigentlich noch niemand von einem "Zweiten Weltkrieg" redete. Der "Weltkrieg" war im öffentlichen Sprachgebrauch immer noch der 1918 zu Ende gegangene. Horkheimers Satz hinterlässt ein leise gespenstisches Gefühl, fast wie der Titel jenes Gedichts, das Stefan George in den zwanziger Jahren verfasst hatte: "Einem jungen Führer im Zweiten Weltkrieg".
Solche Entdeckungen aber macht man in den Werken der akademischen Historiographie eher selten; Sätze wie der von Horkheimer liegen oft unterhalb des Aufmerksamkeitsradars, den sich die Geschichtswissenschaft zur Erfassung ihrer Befunde habituell eingestellt hat. Es musste deshalb ein Literat sein, der aus dem Stimmengewirr der Zwischenkriegszeit und der ersten Monate des Krieges solche Äußerungen dokumentierte: Der amerikanische Schriftsteller Nicholson Baker hat es in "Menschenrauch" getan.
Nun ist Dokumentarliteratur nie ganz so unschuldig und unparteiisch, wie ihre Form es suggeriert. Auch Nicholson Baker hat ein Anliegen, wenn er das Panorama oder eher das Pandämonium seiner Stimmen entfaltet. Er kennt nur zwei Parteien: die Kriegspartei auf allen Seiten und die Partei des Friedens, die der britischen und amerikanischen Pazifisten, der Quäker, die der humanitären Hilfsorganisationen, die der Zivilisten schließlich. Das ist ein anderer Blick als der gewohnte, und man hat ihn Baker als Naivität vorgehalten, wenn man nicht Schlimmeres, "Revisionistisches", wie es heute heißt, dahinter vermutete. Ein solches Urteil aber ginge in die Irre; Baker will ja keinesfalls nachträglich eine prodeutsche Sicht der Dinge durchsetzen; eher ist er ein grundsätzlicher Antipolitiker. Und wenn es das alte Vorrecht der Dichter ist, eine Gegengeschichte zur offiziellen zu verfassen und dafür verbannt zu werden wie Ovid oder Mandelstam, dann hat auch Baker, der Romancier, dieses Recht. Für ihn läuft der Weg in den Krieg über viele kleine Stationen, die am Ende in die Katastrophe münden; Fanatismus hüben und drüben, Verachtung des Lebens von Zivilisten, Phlegma und Mitschwimmen bei den Besseren, die das Schlimmste verhindern könnten. Dazwischen ergreifende Momente der Menschlichkeit. So hat Tolstoi in der Erzählung "Hadschi Murat" den ersten Tschetschenien-Feldzug im neunzehnten Jahrhundert geschildert, so betrachtet Baker den Zweiten Weltkrieg.
Sein Buch beginnt mit dem Treffen zwischen Alfred Nobel, dem Sprengstofffabrikanten und Erfinder des Dynamits, und der frühen Pazifistin Bertha von Suttner. Nobel sah in seinen Produkten eine Sicherung des ewigen Friedens: "An dem Tag, da zwei Armeekorps sich gegenseitig in einer Sekunde werden vernichten können, werden wohl alle zivilisierten Nationen zurückschaudern und ihre Truppen verabschieden." Mit dem Jahresende 1941 schließt Baker, der Mihail Sebastian, einem Verfolgten, das letzte Wort lässt: "Immerhin, wir sind noch am Leben. Wir können noch warten. Noch ist Zeit, noch haben wir Zeit."
Dazwischen hören wir: Victor Klemperer, der die Verfolgung der Juden in Deutschland festhält, Hitler, Heydrich, den zögernden Chamberlain, den bellizistischen Churchill, Roosevelt (auch er gespenstisch: über Briefmarkenalben gebeugt, als Pearl Harbor schon kaputt ist), die Herren des britischen "Bomber-Command", die Strategen der Aushungerung ganzer Bevölkerungen, amerikanische Kriegshysteriker ebenso wie Pazifisten. Natürlich ist die Auswahl begrenzt. Zu den schönen Erträgen dieses Buches gehört die Entdämonisierung der amerikanischen Isolationisten, die zuletzt, in dem Roman "Die Verschwörung gegen Amerika" von Philip Roth, allzu sehr als fünfte Kolonne des Feindes verzeichnet worden waren. Aber Baker kann zeigen, dass weder Charles Lindbergh noch der Senator Burton Wheeler, die Sprecher der Bewegung "America First", vor den Judenverfolgungen in Deutschland die Augen verschlossen.
Diese Verfolgung hatte im April 1933 mit dem Boykott jüdischer Geschäfte begonnen. Wie unermesslich die Aufgabe ist, die sich Baker gestellt hat, nämlich die wirklichen Stimmen des zwanzigsten Jahrhunderts zu sammeln, nicht die heute erwünschten, und wie viel dabei noch zu tun bleibt, erkennt man, wenn man liest, was Gershom Scholem, der schon lange keine Zukunft für die Juden in Deutschland mehr sah, an Walter Benjamin am 13. April 1933 über den Boykott schrieb: "Das Schreckliche an der Sache ist aber, wenn man das überhaupt wagen darf zu sagen, dass es der menschlichen Sache des Judentums in Deutschland nur fruchtbar sein kann, wenn anstelle des kalten Pogroms, den man versuchen wird einzuhalten, ein echter träte. Es ist fast die einzige Chance, in solcher Explosion etwas Positives hervorzurufen."
Aber diese Passage kommt bei Baker nicht vor, der sich auf Quellen stützen muss, die in den Vereinigten Staaten zugänglicher sind. Man kann deshalb manche Ausfälle in dem ungemein reichen Buch beklagen. Zu den empfindlicheren gehört, dass der Name Stalin zwar fällt, dass aber der sowjetische Führer nicht als ein Akteur erscheint, der eigene Ziele verfolgte. So fällt ganz aus der Betrachtung heraus, dass er in Absprache mit Hitler den östlichen Teil Polens besetzte, auch der Winterkrieg gegen Finnland fehlt, der am 30. November 1939 begann, nachdem die finnische Regierung ein Gebiet nicht abtreten wollte. An der Eskalation, die dann zum wirklichen Weltkrieg führte, hat Stalin keinen geringen Anteil.
Aber erst 1941 taucht Stalins Name bei Baker wieder auf, nach dem deutschen Angriff, und er erscheint als der naive, treuherzig auf den Pakt vertrauende Staatsmann. Ausgerechnet er, der mit Scharfsinn und Paranoia alle inneren Feinde, wirkliche und imaginierte, ausgeschaltet hatte, sollte im Frühjahr 1941 ganz ahnungslos gewesen sein, er sollte seinerseits von strategischen Planungen, wann und wie nun doch in den Krieg einzugreifen sei, völlig abgesehen haben? Spätestens seit Molotows Besuch in Berlin im Herbst 1940 musste klar sein, dass weder die Sowjets auf Hitlers Vorschlag eingehen würden, sich nach Süden und Osten zu wenden, also gegen die britischen Interessen in Indien, noch auch, dass Deutschland das ominöse Orakelwort Molotows von einer noch zu klärenden "schwedischen Frage" positiv hätte beantworten können. Und als Ende März 1941 Jugoslawien erst den Beitritt zur Achse Italien-Deutschland erklärte, dann aber binnen Tagen die dafür verantwortliche Regierung weggeputscht und durch eine proalliierte ersetzt wurde, die mit Stalin einen Freundschaftspakt schloss, da konnte auch der Frömmste nicht mehr an einen weiteren Bestand des deutsch-sowjetischen Abkommens vom August 1939 glauben. Baker ist eben wenig "revisionistisch" in einem historischen Sinn.
Wenn nun dieser ganze Schauplatz, diese ganze Sequenz der Ereignisse bei ihm ausfällt, dann ist der Grund wohl eine tatsächlich unpolitische oder, freundlicher gesagt, überpolitische, rein menschliche Betrachtung der Dinge. Aber selbst diese Beschränkung vorausgesetzt, wäre ein Wort zu der Mordaktion der Sowjets an polnischen Offizieren in Katyn à propos gewesen.
Die Struktur der Erzählung, die aus Bakers Collage aufscheint, hat als ein humanitäres Hauptmotiv das Zögern des Westens angesichts der Flüchtlingsmassen aus Deutschland bei gleichzeitiger Aufrüstung. Vieles von dem Zynismus, den man mit Schaudern lesen muss, ergibt sich aus der geostrategischen Lage Großbritanniens, vor allem die frühe Entscheidung für den Bombenkrieg als "moralische" Waffe gegen zivile Ziele. Churchill macht hier keine gute Figur. Weil es aber Churchill war, der für die Regierung Bush als legitimierendes Ideal ihres Kriegs im Irak diente, musste Baker mit diesem Buch auf vehementen Widerstand der Kritiker aus dem Lager der neokonservativen Kriegspartei von heute stoßen. Der deutsche Leser hat die Chance, sich von solchen Befangenheiten frei zu machen.
Nicholson Baker: "Menschenrauch". Wie der Zweite Weltkrieg begann und die Zivilisation endete. Aus dem Amerikanischen von Sabine Hedinger und Christiane Bergfeld. Rowohlt Verlag, Reinbek 2009. 636 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main