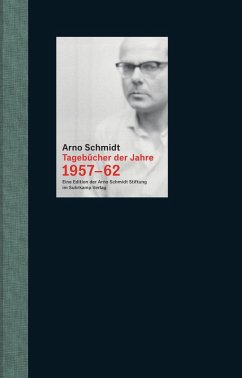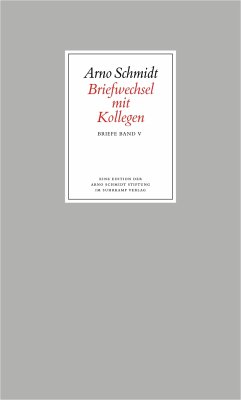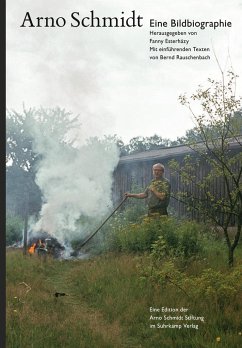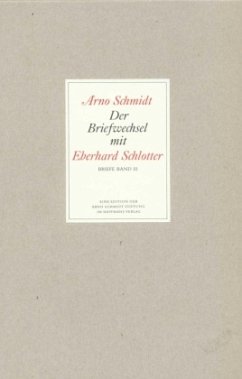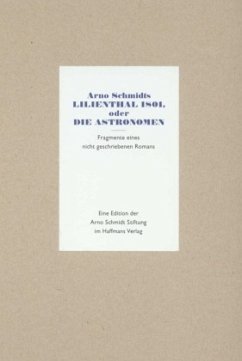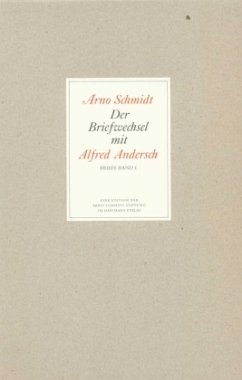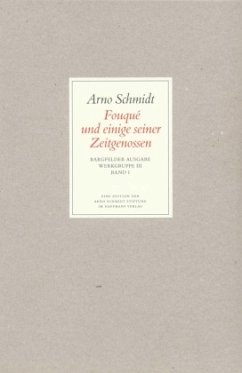Bargfelder Ausgabe. Briefe von und an Arno Schmidt
Band 4: Der Briefwechsel mit Hans Wollschläger
Herausgegeben: Damaschke, Giesbert
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
68,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Eine einzigartige Korrespondenz beginnt im September 1957 zwischen Arno Schmidt und dem jungen Mitarbeiter des Karl-May-Verlags, Hans Wollschläger. Zu Beginn kreist der Briefwechsel, noch förmlich, um das Spätwerk Karl Mays und die umstrittenen Bearbeitungen der Texte durch den Verlag. Doch schon bald wird der Kontakt intensiver und persönlicher, der Ton freier. Wollschläger nimmt unter Arno Schmidts Briefpartnern eine Sonderstellung ein: Schmidt akzeptiert ihn als Kollegen und bemüht sich, ihn als Autor und Übersetzer zu fördern. Er vermittelt Aufträge und setzt sich nachdrücklich f...
Eine einzigartige Korrespondenz beginnt im September 1957 zwischen Arno Schmidt und dem jungen Mitarbeiter des Karl-May-Verlags, Hans Wollschläger. Zu Beginn kreist der Briefwechsel, noch förmlich, um das Spätwerk Karl Mays und die umstrittenen Bearbeitungen der Texte durch den Verlag. Doch schon bald wird der Kontakt intensiver und persönlicher, der Ton freier. Wollschläger nimmt unter Arno Schmidts Briefpartnern eine Sonderstellung ein: Schmidt akzeptiert ihn als Kollegen und bemüht sich, ihn als Autor und Übersetzer zu fördern. Er vermittelt Aufträge und setzt sich nachdrücklich für seinen Roman Herzgewächse oder der Fall Adams ein. 1964 beginnen sie damit, das Gesamtwerk Edgar Allan Poes ins Deutsche zu übersetzen. Nicht in gemeinsamer Arbeit, aber in regelmäßigem Austausch über Autor und Werk. Erst als Schmidt sich in die Arbeit an Zettel's Traum zurückzieht, wird der Kontakt spärlicher, bis Schmidt völlig verstummt.
Der Band präsentiert neben den Briefen Schmidts und Wollschlägers die Korrespondenz zwischen Alice Schmidt und Hans Wollschläger, den Briefwechsel zwischen Arno Schmidt und dem Karl-May-Verlag sowie zahlreiche ergänzende Dokumente.
Der Band präsentiert neben den Briefen Schmidts und Wollschlägers die Korrespondenz zwischen Alice Schmidt und Hans Wollschläger, den Briefwechsel zwischen Arno Schmidt und dem Karl-May-Verlag sowie zahlreiche ergänzende Dokumente.