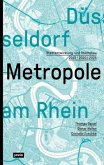Woran erkennt man auf dem Bild einer Straße, um welche Stadt es sich handelt, auch wenn kein bekanntes Wahrzeichen zu sehen ist?
An den kleinen, aber charakteristischen Objekten des Stadtraums: den Brunnen (Berliner Pumpen, Züricher Gusseisenbrunnen, Pariser Wallace Brunnen), den Baumscheiben, Pollern, Stadtmöbeln, aber auch am Belag, Trottoir oder den Kanaldeckeln.
Lampugnani hat über viele Jahre die Geschichte dieser Objekte erforscht, hat 22 repräsentative herausgesucht und erzählt uns ihren Werdegang: beginnend mit ihrem ersten Auftreten (oft schon in der Antike), ihrer Vernachlässigung (meist im Mittelalter), ihrer neuen Blüte oder ihrem erstmaligen Erscheinen (in der Stadt der Neuzeit) bis hin zu ihrer Verlotterung und Verhässlichung in der Gegenwart. Oder geht ihrem kurzem Leben nach wie dem der Telefonzelle, die, kaum erfunden, schon wieder den technischen Neuerungen zum Opfer fiel.
Was entsteht, sind nicht nur kenntnisreiche Einblicke in bisher unterschätzte Elemente der Stadt und amüsante Anekdoten aus der Geschichte des Städtebaus und einzelner Städte. En passant erzählt Lampugnani auch, was eine Stadt schön, individuell und unverwechselbar macht. Und was wir heute manchmal leichtfertig aufs Spiel setzen.
An den kleinen, aber charakteristischen Objekten des Stadtraums: den Brunnen (Berliner Pumpen, Züricher Gusseisenbrunnen, Pariser Wallace Brunnen), den Baumscheiben, Pollern, Stadtmöbeln, aber auch am Belag, Trottoir oder den Kanaldeckeln.
Lampugnani hat über viele Jahre die Geschichte dieser Objekte erforscht, hat 22 repräsentative herausgesucht und erzählt uns ihren Werdegang: beginnend mit ihrem ersten Auftreten (oft schon in der Antike), ihrer Vernachlässigung (meist im Mittelalter), ihrer neuen Blüte oder ihrem erstmaligen Erscheinen (in der Stadt der Neuzeit) bis hin zu ihrer Verlotterung und Verhässlichung in der Gegenwart. Oder geht ihrem kurzem Leben nach wie dem der Telefonzelle, die, kaum erfunden, schon wieder den technischen Neuerungen zum Opfer fiel.
Was entsteht, sind nicht nur kenntnisreiche Einblicke in bisher unterschätzte Elemente der Stadt und amüsante Anekdoten aus der Geschichte des Städtebaus und einzelner Städte. En passant erzählt Lampugnani auch, was eine Stadt schön, individuell und unverwechselbar macht. Und was wir heute manchmal leichtfertig aufs Spiel setzen.

Anleitung zum Stadtstreunen: Vittorio Magnago Lampugnani widmet sich den kleinen Dingen urbaner Architektur.
E ist ein Stadtliebhaber, der keine Marginalisierung duldet - möge das urbane Leben die Sinne überfluten. Der Architekturtheoretiker Vittorio Magnago Lampugnani findet die nötige Distanz, um den übersehenen Mehrwert von Verkehrsampeln und Schachtdeckeln zu erkennen.
"Berlin hat mich im höchsten Grade überrascht", schrieb Mark Twain nach seinem fünfmonatigen Aufenthalt. 1892 kehrte er nach Chicago zurück. Aber das hauptstädtische Straßensystem ließ ihn nicht mehr los. In seinen Erinnerungen wunderte er sich darüber, dass sich der Straßenname zuweilen mitten in der Häuserreihe änderte. Die Numerierung war ohnehin nicht nach seinem Geschmack. Man startete am innerstädtischen Ende einer Straße und numerierte die Häuser fortlaufend. Erst am Ende nahm man sich die andere Straßenseite vor und kehrte zurück. Das Ergebnis: Am Straßenanfang begegnete die niedrigste Nummer der höchsten. Als wäre dies nicht verwirrend genug, gesellte sich zu dem Hufeisenverfahren bald das französische Zickzacksystem. Das Nebeneinander veranlasste Twain zu einer Schimpftirade: "Zunächst denkt man, dies sei das Werk eines Idioten, aber dafür ist die Sache zu abwechslungsreich. Ein Idiot könnte sich nicht so viele Methoden ausdenken, Konfusion zu schaffen . . .".
Diese Meinung teilten offenbar auch die Nationalsozialisten. Ihre zukünftige Welthauptstadt Germania durfte nicht im Ziffernchaos versinken. Hier und da schafften sie tatsächlich Ordnung. Die Friedrichstraße blieb trotzdem weiterhin fortlaufend numeriert. Und auch der Kurfürstendamm präferiert bis heute das Hufeisen. Aber steht Berlin mit diesem strukturellen, von seinen Bewohnern kaum wahrgenommenen Problem allein da? Keineswegs, wie Vittorio Magnago Lampugnani in seinem neuen Buch zu erzählen weiß. In Florenz und Genua sorgt eine Numerierung mit schwarzen Ziffern für Wohnhäuser und mit roten für Geschäfte für Kopfschütteln bei Nichtansässigen. In Tokio bekommen Häuser gar eine Nummer in der Reihenfolge ihrer Entstehung. Ganz zu schweigen von der Gestaltung der Hausnummern, die nicht selten den Hauseigentümern überlassen wurde.
Das Paris der Jahrhundertwende trieb es mit skulptural blühenden Schildern eines Hector Guimard, auf dessen Konto auch die filigranen Métro-Eingänge gehen, besonders bunt. Für Lampugnani übertreffen sie die schlimmsten Albträume jedes Stadtliebhabers. Er wünscht sich, natürlich begleitet von einem Augenzwinkern, jene souveräne Ruhe im öffentlichen Raum zurück, "die seit jeher eine seiner eminenten Qualitäten war".
Der Architekt, emeritierter Professor an der ETH Zürich und Städtebautheoretiker, 1951 in Rom geboren, hat mit seiner Studie "Die Stadt im 20. Jahrhundert" (2010 bei Wagenbach) einen Klassiker geschrieben, nicht nur für Architekturhistoriker. Von ihm stammt der Satz: "Architektur und Stadt können keine Wegwerfprodukte sein; sie müssen dauern." Und das gilt bei Lampugnani auch für die unscheinbaren Details wie Mülleimer, Poller, Sitzbänke, Kioske oder Stadtuhren, deren Geschichte er sprachlich gewandt nachzeichnet.
Gerade diese kleinen Dinge sind es, glaubt er, an denen man die Ästhetik einer Stadt, das unverwechselbare Flair jenseits ihrer Wahrzeichen erkennt. Ohne sie wäre der Stadtraum ein anderer. Man denke nur an den Bedeutungsverlust von Wasserpumpen, die ihre hygienische und auch soziale Funktion mit dem Aufkommen der Wasserleitungen verloren. Oder das Verschwinden der roten Telefonzellen in London. Dass die Berliner Fernsprecher in den zwanziger Jahren an ihrer Hinterseite Briefmarken und Postkarten "spendeten", ist heute ohnehin nur noch als ein Kuriosum aussterbender Kulturtechniken abgespeichert.
Zweiundzwanzig bedeutsame Belanglosigkeiten" listet der akribische Flaneur auf, durchleuchtet die Etappen ihrer Entstehung und spannt den Bogen bis in die Gegenwart, die aus Kostengründen das Fortbestehen dieser "Mikroarchitekturen" gefährdet. Nicht so die öffentliche Toilette. Selbstverständlich nimmt Lampugnani auch diese Institution ins Visier, die im neunzehnten Jahrhundert Architekten veritable Pavillons mit allem Komfort entwerfen ließ, darunter auch das Berliner "Café Achteck", das zum Treffpunkt von Homosexuellen avancierte.
Anekdotenreichtum und ein bewundernswert weit verzweigtes Wissen gehen in dieser Anleitung zum bewussten Stadtstreunen Hand in Hand. Dass Karl Phillipp Moritz etwa die neapolitanischen Stadträume mit Wohnräumen verglich und Goethe den Bodenbelag aus schwarzen Lava-Steinen schätzte, dürfte beim nächsten Besuch der Stadt am Vesuv eine andere Blickrichtung bescheren.
Und weil das Auge immer mitspaziert, garniert Lampugnani seine Exkursionen mit Abbildungen von alten Stichen, Skizzen und Postkarten. Beim Stichwort "Schaufenster" ist es der Maler August Macke, der mit dem Gemälde "Frau mit Sonnenschirm vor Hutladen" in das Jahr 1914 entführt. Die "Reklame" illustriert eine Fotografie von Erich Mendelsohns "Kaufhaus Schocken". Man kann sich nicht zuletzt auch an dieser zeitlich hin und her springenden visuellen Schatztruhe nicht sattsehen.
ALEXANDRA WACH
Vittorio Magnago
Lampugnani: "Bedeutsame Belanglosigkeiten". Kleine Dinge im Stadtraum.
Wagenbach Verlag,
Berlin 2019.
192 S., Abb., geb., 30,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main