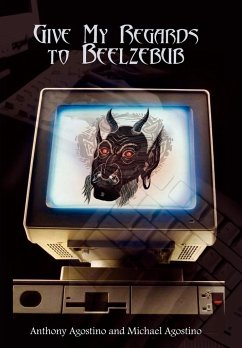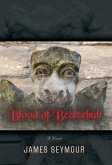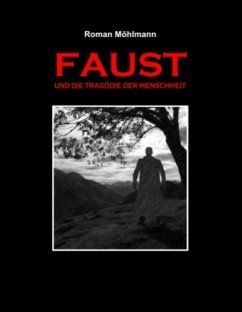"Ein sehr schöner diabolischer Entwicklungsroman, aber mit Speed und Karacho, vorbei an der schöngeistigen Literatur, quer durchs Triviale, hin zu neuen Ufern."Der Berliner Antiquariatsgehilfe Julian Mark ist auf der Suche nach Weisheit, wünscht sich nichts sehnlicher als älter zu werden und wird immer wieder von Selbstmordgedanken gequält. Doch als er von seinem Chef einem Teufel übergeben wird und sich selbst in einem halben Beelzebub verwandelt hat, übernimmt er die Geschäfte und wird aktiv. Bald jedoch scheitert er, wird von einer geheimnisvollen Sekte heimgesucht und entscheidet sich zur Flucht. Diese führt ihn in die Hölle, wo man ihn schnell als unechten Beelzebub entlarvt und verjagt. Wieder auf der Flucht kehrt er, zunächst auf einem Yeti reitend, dann über viele Umwege auf einem Containerschiff Calais erreichend, nach Berlin zurück. Dort gibt er sich als Yetiforscher aus, scheitert jedoch und findet sich auf der Straße wieder.Mit brachialer Kraft durchpflügt dieser monumentale Roman lustvoll prall und anspielungsreich mythologische und reale Landschaften, besucht Himmel und Hölle, setzt sich über alle Zeiten hinweg. Am Ende seiner Odyssee legt der Autor schließlich in einem Fluss aus Traum und Wirklichkeit selbst sein Haupt aufs Schafott der Zeit legt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Das steht da einfach so: Stefan Schütz fährt zur Hölle und findet seinen Roman in Beelzebubs Bibliothek
Ein Traum hat sich erfüllt: Nach Jahren unverdrossener Schreibarbeit, lange unerfüllter Hoffnung, Jahren auch des Zweifelns wie Verzweifelns hält Harpo sein Buch "B", wie er es nennt, in Händen. Oft musste er befürchten, diesen Moment nie zu erleben. Nächtelang hat er geträumt, wie es sich anfühlt, und gebangt, dass es am Ende doch nicht wahr wird. Nun, da es der Fall ist, verspürt er ein dermaßen starkes Glücksgefühl, dass Harpo sich mit Hilfestellung seiner Frau "vom Stau im Samenkanal" befreit und "Erleichterung" verschafft. Zwei Seiten später sind auch wir erleichtert: auf Seite 937 endet der Roman. Was aber haben wir gelesen?
Gewiss den ungewöhnlichsten und sperrigsten wie auch befremdlichsten Roman, der uns seit langer Zeit begegnet ist, eine sechsteilige Großerzählung um einen Berliner Antiquariatsgehilfen namens Julian Mark, die ihren Helden buchstäblich durch die Welt zur Hölle schickt (den Himmel spart sie weitestgehend aus). Sie nennt sich selbst einen "diabolischen Entwicklungsroman" und liefert gern an vielen Stellen unsere Lesereaktion gleich mit. So besucht Mark bei seinem Höllenaufenthalt das "Archiv des Cerberus", in dem, wie man erfährt, regaleweise Manuskripte lagern. Auch das gesamte "Buch des Beelzebub", das wir gerade lesen, findet sich dort offenbar, bislang jedoch noch nicht im Druck - einziger Trost: "wenigstens die Schublade für die Ewigkeit sei dem Geschriebenen sicher". Dann aber redet ein Höllenangestellter Klartext: "Einer, der bei Cerberus Manuskripte schleppt, hat deinen Roman gelesen. Schöner Stuss, wie er sagt." Es fällt schwer, dem nicht von Herzen beizupflichten.
Seit langem zählt es zu den sinnreichsten Manövern von Romanen, ihr eigenes Entstehen gleich mit zu erzählen. In "Robinson Crusoe" beispielsweise lesen wir nicht nur von den Abenteuern eines Schiffbrüchigen, sondern auch davon, wie dieser Geschäftemacher sich als Autor neu erfindet und die Geschichte, die uns vorliegt, niederschreibt. Auf diese Art gelingt es dem Roman, seinen Fiktionscharakter zu verbergen und sich als Bestandteil unserer Welt zu verbürgen: Indem wir lesen, beglaubigen wir ein Produkt der Phantasie. Selten aber wurde dieses Spiel so weit wie hier getrieben. Nicht nur kokettiert die Großerzählung immer wieder, wie zitiert, mit den Lektüreschwierigkeiten, die sie uns zumutet. Der gesamte sechste Teil - ein einziger, so gut wie absatzloser, über hundertseitiger Wortschwall, der überwiegend aus Traumprotokollen zu bestehen scheint, ohne dass die Grenzziehung zum Wachbewusstsein durchgehend gelingt - setzt das Erscheinen des Romans in Szene, mit allen Einzelheiten wie den Nachrichten des Lektors, der mit dem Kürzel "HUMS" belegt wird, oder der ISBN des Romans, die dem Autor eines Nachts glücklich vor Augen steht. Dass diese Autorenfigur "Harpo" heißt und damit ausgerechnet auf denjenigen der Marx Brothers verweist, der sich stets wortlos nur mit Hupen, Pfeifen oder Harfenspiel verständlich macht, ist eine seiner besseren Pointen.
Tatsächlich ist "Beelzebub", Teil I bis V, schon mal erschienen. 2011 brachte es der Autor als Privatdruck heraus, von einem Freundeskreis gefördert, mit maßgeblicher Unterstützung des legendären Suhrkamp-Lektors und Einar Schleef-Gefährten Hans-Ulrich Müller-Schwefe. Offenkundig hatte das umfangreiche Manuskript damals schon eine längere Geschichte. Der Autor Stefan Schütz, Jahrgang 1944, zunächst als Schauspieler sowie Dramatiker bekannt geworden und 1981 aus der DDR in den Westen gekommen, begann in den achtziger Jahren mit der Veröffentlichung von Erzählprosa, zunächst bei Rowohlt, dann bei Suhrkamp. Danach erschien lange Zeit nichts mehr, so dass der Name nur noch wenigen bekannt blieb, ein Solitär im Literaturbetrieb. Dabei hatte er für seinen ersten Großroman "Medusa" 1986 den von Günter Grass gestifteten Alfred-Döblin-Preis erhalten. Schon damals allerdings bemerkte der Laudator F. C. Delius, das Werk sei "eine Zumutung, ja eine Unverschämtheit im besten Sinne".
Vor zwei Jahren dann erschien im Verlag Matthes & Seitz "Unser Leben", eine knappe, ungemein intensive, so sprachmächtig wie anrührende Erzählung, in der Schütz verarbeitet, wie seine Frau an Demenz erkrankt und sich in der Vergessenheit einrichtet. Dem verdienten Erfolg dieses Titels ist es wohl zu danken, dass derselbe Verlag nun doch die richtige Publikation des kompletten "Beelzebub" wagt: Ein Traum hat sich erfüllt, für "Harpo" jedenfalls.
Den Lesern aber, auch geübten und geduldigen, wird das Buch bald zum Albtraum. Was immer sich hier an erkennbaren Figuren, Schauplätzen und Handlungsfäden abzeichnet, verunklart und verwirrt sich schnell - vor allem durch die mächtig aufgeladene, teils expressionistisch glühende, oft aber nur verschwurbelte Sprache: "Er ritt über die Klippen des Äthers und sah die Wogen der Geschichte schäumend gegen sie branden, eine Fähre, gebaut für den Transfer in die Zukunft, ließ mit schwerer Eisenkette den Anker in die Tiefe gleiten, allein hier gibt es keinen Boden mehr, nur noch Flut, und es wird so kommen, wie es muss, auch dieses stolze Schiff zerschellt und keine Rettung für Mann und Maus." Nun gut, es geht um einen Hexenritt und eine Art Walpurgisnacht. Doch wer Dämonen wirksam entfesseln will, tut gut daran, zunächst den Boden zu bereiten und uns die Wirklichkeit, in die der Schrecken einbricht, zu vermitteln. Dies ist das Prinzip aller großen Teufelserzählungen vom Volksbuch des Doktor Faustus bis zu Bulgakov. Doch daran hat "Beelzebub" wenig Interesse.
Eine Handlung nachzuerzählen erübrigt sich damit. Denn auch wer sich redlich müht und auf die Sprache einlässt, gibt viel an Lebenszeit in die Lektüre und erhält doch kaum etwas zurück: Es bleibt ein Buch, das einem bis zuletzt den Rücken zukehrt. Man klammert sich an Einzelheiten wie an Strohhalme, um im monomanen Malstrom dieser Prosa nicht jeden Richtungssinn zu verlieren. Doch mehr als ein paar Seiten lang behält man keinen Durchblick, zu wirr, verschlungen und verblasen, allzu verliebt in seine sämtlichen Versponnenheiten (über Hunderte von Seiten enden alle Sätze mit Ausrufezeichen und sind durch drei Punkte voneinander getrennt! ... Eine syntaktische oder prosodische Motivation dafür erschließt sich nicht! ... Das steht da einfach immer so! ...) wirkt dieses Buch.
Das Monumentale, ja Monströse schüchtert ein und soll das vielleicht geradezu. Es hat in der Moderne nicht an wuchtigen Textauftürmungen gefehlt - von Pound und Joyce bis Schmidt und Jahnn -, die sich dem Eingängigen bewusst sperrten und somit kaum an üblichen Verfahren von Erzählung im Sinne einer Übermittlung, Leserführung oder auch -verführung interessiert waren. Selten aber hat man einen derart ausschweifenden, dazu redseligen Text gelesen, der sich so wenig - so vorsätzlich wenig - um Lesbarkeit zu scheren scheint und sich dermaßen selbstbezogen wie auch selbstbezüglich gibt, dass man sich fühlt wie ein geladener Partygast, der doch den ganzen langen Abend mit keinem ein Wort wechseln kann: Alle reden über Dinge, die einem irgendwie nichts sagen. Ob das die wahre Hölle ist?
Natürlich lässt sich mutmaßen, dass genau dieser Effekt kalkuliert ist, wir also eben der Erfahrung des Verstörenden, Verwirrenden teilhaftig werden sollen. Ohnehin geht alles Dunkle, Schwere, Undurchschaubare hierzulande gern als Anspruchsvolles durch. Und selbstverständlich mangelt es auch nicht an hochkulturellen Referenzen, von Gibbon über Wieland und Jean Paul bis zu Müller, sowie gewichtigen Sentenzen ("Wie der Schamane sagt ... Die Geburt ist wahr, der Tod ist wahr, alles andere ist unwahr ..."). Doch all das ermüdet.
So nehmen wir die Lektüre am besten wohl als Selbstversuch und melden als Proband Erschöpfung. Vielleicht probieren wir es wieder, wenn wir wie Robinson auf einer Insel stranden. Bis dahin legen wir diesen Roman getrost in der Schublade für die Ewigkeit ab.
TOBIAS DÖRING
Stefan Schütz: "Beelzebub". Roman.
Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2018. 944 S., geb., 30,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Mit überbordender Fantasie stellt Stefan Schütz die Frage, welch einen Sinn so ein kleines, vertracktes, teuflisches Menschenleben wohl haben kann. Sein Buch ist anspielungsreich wie unterhaltend, wunderbar gelehrt und hinreißend komisch. So ein Roman erscheint nur alle paar Jahre« - Mario Scalla, hr2-kultur Mario Scalla HR2 - Hessischer Rundfunk 20180621