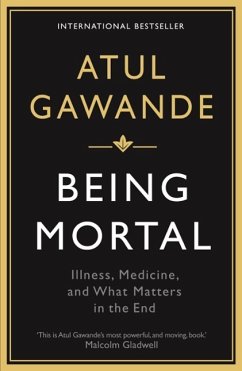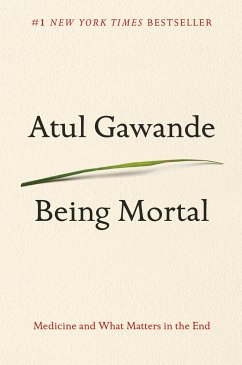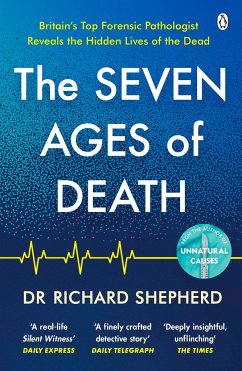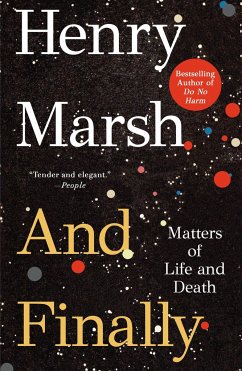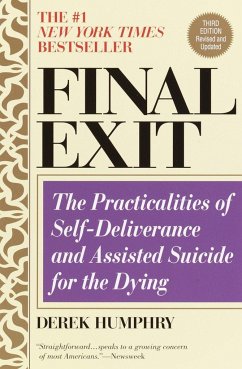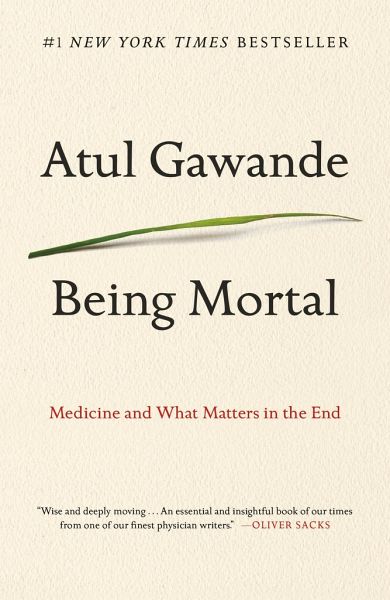
Being Mortal
Medicine and What Matters in the End
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
9,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
5 °P sammeln!
Medicine has triumphed in modern times, transforming the dangers of childbirth, injury, and disease from harrowing to manageable. But when it comes to the inescapable realities of aging and death, what medicine can do often runs counter to what it should. Through eye-opening research and gripping stories of his own patients and family, Gawande reveals the suffering this dynamic has produced. Nursing homes, devoted above all to safety, battle with residents over the food they are allowed to eat and the choices they are allowed to make. Doctors, uncomfortable discussing patients' anxieties about death, fall back on false hopes and treatments that are actually shortening lives instead of improving them. And families go along with all of it. In his bestselling books, Atul Gawande, a practicing surgeon, has fearlessly revealed the struggles of his profession. Now he examines its ultimate limitations and failures--in his own practices as well as others'--as life draws to a close. Riveting, honest, and humane, Being Mortal shows how the ultimate goal is not a good death but a good life--all the way to the very end.
Die Medizin scheint über Krankheit und Tod zu triumphieren, doch sterben wir so trostlos wie nie zuvor. Der Bestsellerautor und renommierte Arzt Atul Gawande schreibt in seinem beeindruckenden Buch über das, was am Ende unseres Lebens wirklich zählt. Ungewöhnlich offen spricht er darüber, was es bedeutet, alt zu werden, wie man mit Gebrechen und Krankheiten umgehen kann und was wir an unserem System ändern müssen, um unser Leben würdevoll zu Ende zu bringen. Ein mutiges und weises Buch eines großartigen Autors, voller Geschichten und eigener Erfahrungen, das uns hilft, die Geschichte unseres Lebens gut zu Ende zu erzählen.