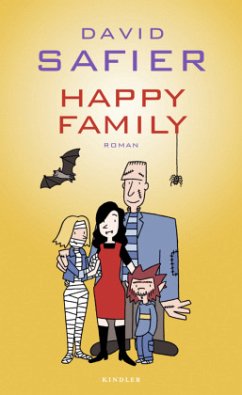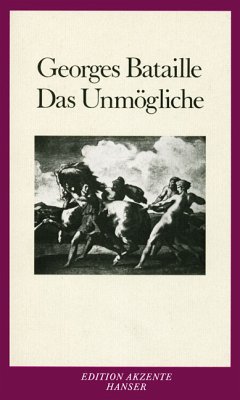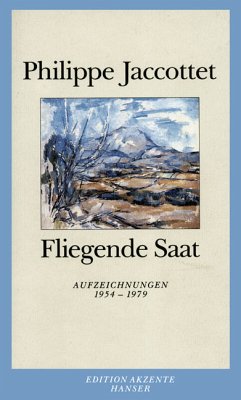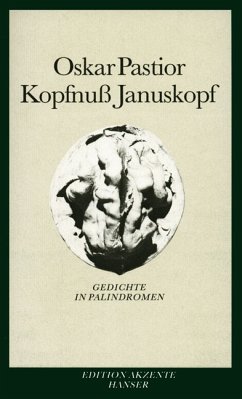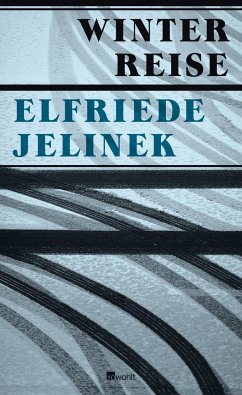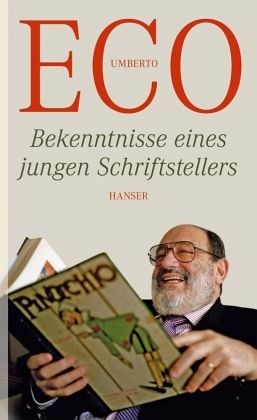
Bekenntnisse eines jungen Schriftstellers
Richard Ellmann Lectures in Modern Literature (Vorlesungen)
Übersetzung: Kroeber, Burkhart

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Sein erster Roman "Der Name der Rose" wurde ein Welterfolg. Jetzt, vor seinem achtzigsten Geburtstag, blickt Umberto Eco zurück auf seine Karriere als Theoretiker und Romancier. Warum sind wir zu Tränen gerührt vom Unglück einer Figur? In welchem Sinne "existieren" Anna Karenina, Gregor Samsa und Leopold Bloom? Auf seiner Reise zu den eigenen kreativen Methoden erzählt Eco, wie er seine Romane geschrieben hat: Am Anfang stehen Szenen und Bilder, dann eine Epoche, ein Ort, eine Stimme. Zugleich Mittelalterforscher, Philosoph und Experte für moderne Literatur, beeindruckt Eco vor allem, we...
Sein erster Roman "Der Name der Rose" wurde ein Welterfolg. Jetzt, vor seinem achtzigsten Geburtstag, blickt Umberto Eco zurück auf seine Karriere als Theoretiker und Romancier. Warum sind wir zu Tränen gerührt vom Unglück einer Figur? In welchem Sinne "existieren" Anna Karenina, Gregor Samsa und Leopold Bloom? Auf seiner Reise zu den eigenen kreativen Methoden erzählt Eco, wie er seine Romane geschrieben hat: Am Anfang stehen Szenen und Bilder, dann eine Epoche, ein Ort, eine Stimme. Zugleich Mittelalterforscher, Philosoph und Experte für moderne Literatur, beeindruckt Eco vor allem, wenn er sich den Wurzeln der Geschichte zuwendet. Der "junge Schriftsteller" ist heute ein Meister, der über die Kunst des Romans und die Kraft der Worte aus langer Erfahrung spricht.