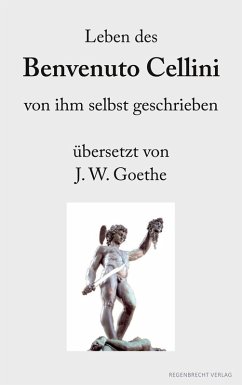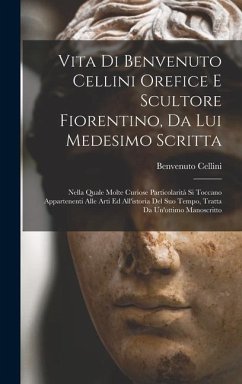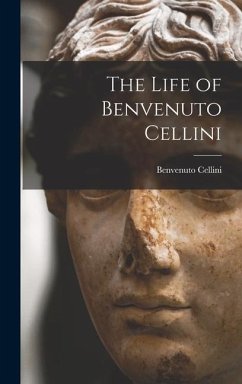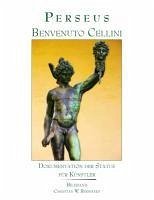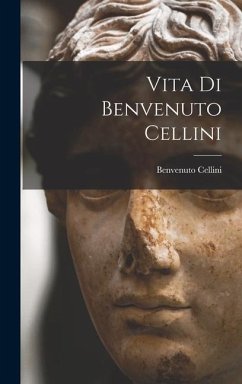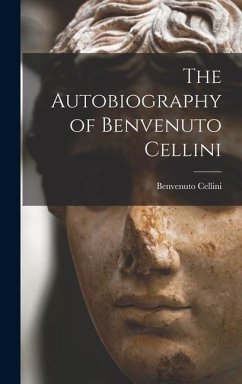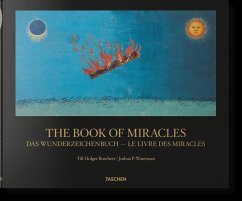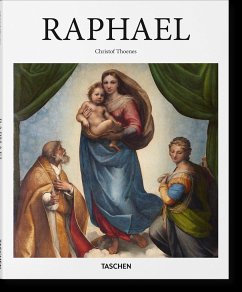Nicht lieferbar

Benvenuto Cellini
Kunst und Kunsttheorie im 16. Jahrhundert
Herausgegeben: Schreurs-Morét, Anna; Nova, Alessandro
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Der Florentiner Künstler Benvenuto Cellini (1500 - 1571) zählte zu den bedeutendsten Goldschmieden, Medailleurs und Bildhauern seiner Zeit. Er arbeitete u. a. für die Päpste in Rom, die Medici in Florenz und den französischen König. Neben seinen Tätigkeiten als Künstler und Handwerker verfasste er mehrere kunsttheoretische Traktate und eine Autobiographie.
Der Band würdigt die verschiedenen Aspekte seines Schaffens. Zunächst wird die kulturelle Situation in Florenz sowie die Beziehung zwischen Kunst und Politik in der Zeit Cosimo I. skizziert, dann folgen Beiträge über die Begriffe idea und disegno, über Cellini als Zeichner, Goldschmied und Bildhauer, die Paragone-Debatte (der sog. "Rangstreit der Künste") und die Frage der Mehransichtigkeit der Skulptur, die Rezeption der Antike in der Zeit Cellinis und die Probleme der Autobiographie.
Der Band würdigt die verschiedenen Aspekte seines Schaffens. Zunächst wird die kulturelle Situation in Florenz sowie die Beziehung zwischen Kunst und Politik in der Zeit Cosimo I. skizziert, dann folgen Beiträge über die Begriffe idea und disegno, über Cellini als Zeichner, Goldschmied und Bildhauer, die Paragone-Debatte (der sog. "Rangstreit der Künste") und die Frage der Mehransichtigkeit der Skulptur, die Rezeption der Antike in der Zeit Cellinis und die Probleme der Autobiographie.