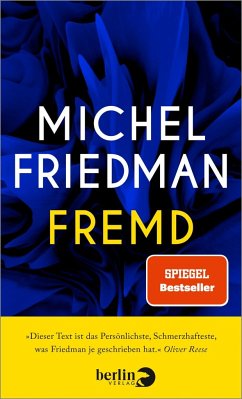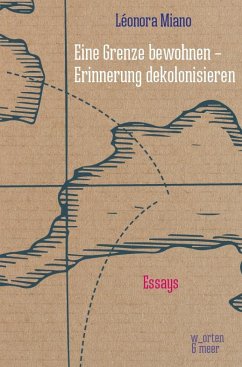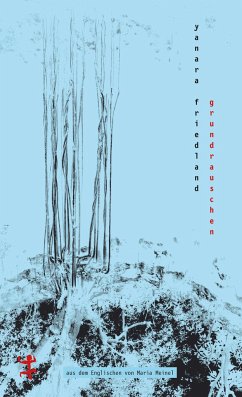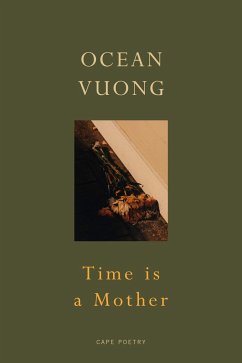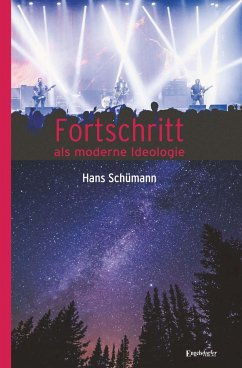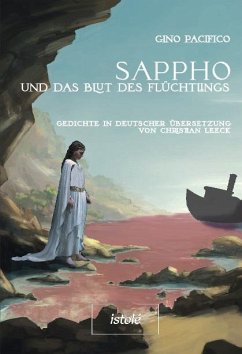Berliner Trilogie
Drei Poeme: Was will Niyazi in der Naunynstraße? Der kurze Traum aus Kagithane. Die Fremde ist auch ein Haus
Übersetzer: Schmiede, H. Achmed; Kraft, Gisela; Theobaldy, Jürgen; Schenk, Johannes
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
22,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die drei Gedichtbände »Was will Niyazi in der Naunynstraße«^(1973), »Der kurze Traum aus Kagithane« (1974) und »Die Fremde ist auch ein Haus« (1980) bilden zusammen die »Berliner Trilogie«. Die Poeme waren unter den ersten literarisch anspruchsvollen und erfolgreichen Texten, die in Deutschland die Situation türkischer Arbeitsmigrant_innen überhaupt thematisierten. »Was will Niyazi in der Naunynstraße«, der Auftakt der Trilogie, diente als Vorlage für mehrere Filme und wurde 1987 von Tayfun Erdem vertont. Ören stellt in diesen Texten das Leben von Arbeiter_innen in der Bundesr...
Die drei Gedichtbände »Was will Niyazi in der Naunynstraße«^(1973), »Der kurze Traum aus Kagithane« (1974) und »Die Fremde ist auch ein Haus« (1980) bilden zusammen die »Berliner Trilogie«. Die Poeme waren unter den ersten literarisch anspruchsvollen und erfolgreichen Texten, die in Deutschland die Situation türkischer Arbeitsmigrant_innen überhaupt thematisierten. »Was will Niyazi in der Naunynstraße«, der Auftakt der Trilogie, diente als Vorlage für mehrere Filme und wurde 1987 von Tayfun Erdem vertont. Ören stellt in diesen Texten das Leben von Arbeiter_innen in der Bundesrepublik und in Berlin in all seiner Widersprüchlichkeit dar. Mit dieser Edition erscheinen die überaus erfolgreichen Bücher nun erstmals in einem Band, mit einem neuen Vorwort des Verfassers.»Aras Ören ist es gelungen, die Spannungen zwischen der trüben Umwelt der Naunynstraße und der Erinnerung an die Türkei, die sich mit den Jahren zur Illusion verdichtet, sowie die Illusion vom Leben in Deutschland und die soziale Realität in der Türkei in kräftigen Bildern und Handlungsabläufen wiederzugeben - ein Zeugnis der türkischen Odyssee und mehr, Zeugnis einer Erfahrung, die nicht nur auf die Türkei zurückwirken wird«, schrieb Ingeborg Drewitz 1973 im Tagesspiegel.