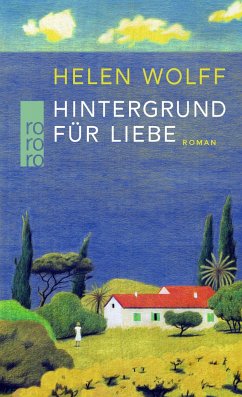Nicht lieferbar

Ungelesenes Mängelexemplar
Minimale äußerliche Macken und Stempel, einwandfreies Innenleben. Schnell sein! Nur begrenzt verfügbar.





Ausgezeichnet mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis, nominiert für den Deutschen Buchpreis, SWR BestenlisteVor dem Hintergrund einer historischen Katastrophe erzählt der Romancier Gert Loschütz eine große, unter die Haut gehende Geschichte von Liebe und Verrat: Im Dezember 1939 kommt es vor dem Bahnhof von Genthin zum schwersten Zugunglück, das sich jemals auf deutschem Boden ereignet hat. Zwei Züge prallen aufeinander, zahlreiche Menschen sterben. In einem davon sitzt Carla, die schwer verletzt überlebt. Verlobt ist sie mit Richard, einem Juden aus Neuss, aber nicht er ist ihr Begleiter...
Ausgezeichnet mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis, nominiert für den Deutschen Buchpreis, SWR Bestenliste
Vor dem Hintergrund einer historischen Katastrophe erzählt der Romancier Gert Loschütz eine große, unter die Haut gehende Geschichte von Liebe und Verrat: Im Dezember 1939 kommt es vor dem Bahnhof von Genthin zum schwersten Zugunglück, das sich jemals auf deutschem Boden ereignet hat. Zwei Züge prallen aufeinander, zahlreiche Menschen sterben. In einem davon sitzt Carla, die schwer verletzt überlebt. Verlobt ist sie mit Richard, einem Juden aus Neuss, aber nicht er ist ihr Begleiter, sondern der Italiener Giuseppe Buonomo, der durch den Aufprall ums Leben kommt. Das Ladenmädchen Lisa vom Kaufhaus Magnus erhält den Auftrag, der Verletzten, die bei dem Unglück alles verloren hat, Kleidung zu bringen. Aber da gibt Carla sich bereits als Frau Buonomo aus. Was versucht sie zu verbergen? Von diesem mysteriösen Vorfall erfährt viele Jahre später Lisas Sohn Thomas Vandersee, dem die Mutter zugleich ihre eigene Liebes- und Unglücksgeschichte erzählt. Kann er Carlas Geheimnis ergründen? Hängt es womöglich mit seiner eigenen Familie zusammen?
Vor dem Hintergrund einer historischen Katastrophe erzählt der Romancier Gert Loschütz eine große, unter die Haut gehende Geschichte von Liebe und Verrat: Im Dezember 1939 kommt es vor dem Bahnhof von Genthin zum schwersten Zugunglück, das sich jemals auf deutschem Boden ereignet hat. Zwei Züge prallen aufeinander, zahlreiche Menschen sterben. In einem davon sitzt Carla, die schwer verletzt überlebt. Verlobt ist sie mit Richard, einem Juden aus Neuss, aber nicht er ist ihr Begleiter, sondern der Italiener Giuseppe Buonomo, der durch den Aufprall ums Leben kommt. Das Ladenmädchen Lisa vom Kaufhaus Magnus erhält den Auftrag, der Verletzten, die bei dem Unglück alles verloren hat, Kleidung zu bringen. Aber da gibt Carla sich bereits als Frau Buonomo aus. Was versucht sie zu verbergen? Von diesem mysteriösen Vorfall erfährt viele Jahre später Lisas Sohn Thomas Vandersee, dem die Mutter zugleich ihre eigene Liebes- und Unglücksgeschichte erzählt. Kann er Carlas Geheimnis ergründen? Hängt es womöglich mit seiner eigenen Familie zusammen?
Gert Loschütz, 1946 in Genthin (Sachsen-Anhalt) geboren, hat Erzählungen, Romane, Gedichte, Hörspiele, Theaterstücke und Filmdrehbücher geschrieben. Er erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, u. a. den Ernst-Reuter-Preis und den Rheingau Literatur Preis. Mit seinem Roman 'Dunkle Gesellschaft' stand er 2005 auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Mit dem Roman 'Ein schönes Paar' (2018) wurde er ebenfalls für den Deutschen Buchpreis nominiert. Außerdem stand der Roman auf der Shortlist für den Wilhelm Raabe-Literaturpreis. Der Autor lebt mit seiner Familie in Berlin.
Produktdetails
- Verlag: btb
- Seitenzahl: 331
- Erscheinungstermin: 13. Dezember 2023
- Deutsch
- Abmessung: 186mm x 118mm x 24mm
- Gewicht: 272g
- ISBN-13: 9783442773053
- ISBN-10: 3442773059
- Artikelnr.: 72171482
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Für den Rezensenten Markus Clauer ist Gert Loschütz ein "stiller Virtuose der Erzählkunst". Und dieses Urteil kann der Kritiker nach Loschütz' jüngstem Roman nur bekräftigen: Während ihm der Autor basierend auf einem Zugunglück im Dezember 1939, bei dem 196 Menschen starben, aus dem Leben der überlebenden "Halbjüdin" Carla Finck erzählt, bewundert Clauer einmal mehr Loschütz' Fähigkeit, Fakten und Fiktion, Protokoll und Poesie miteinander zu verbinden. Und mitunter zerreißt dem Kritiker dieser Blick auf ein siebzigjähriges Leben das Herz.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Loschütz kann eigentlich gar nicht genug Preise bekommen.« Gerrit Bartels / Der Tagesspiegel»Wie von außen betrachtet Loschütz seine Figuren und das Geschehen. Im Weitwinkel: 70 Jahre. Mit Zoom: vier Sekunden. Der Ton schwankt zwischen Protokoll und poetischer Präzision.« Markus Clauer / Die Zeit»Als einen Favoriten für den Deutschen Buchpreis muss man Gert Loschütz ansehen, der sich im zweiten Sommer seiner Schriftstellerkarriere anschickt, endlich den großen Durchbruch zu schaffen.« Andreas Platthaus / Frankfurter Allgemeine Zeitung»So gelingt es dem Autor, nahtlos überzuleiten und über zwei Frauen zu schreiben, deren Leben er wirklich großartig nachzeichnet.« Thomas Mahr / LesArt»Gert Loschütz hat einen mit großer Empathie erzählten
Mehr anzeigen
(...) Roman geschrieben, der ein furchtbares Unglück, verbriefte Zeitgeschichte und private Katastrophen mit leichter Hand zwischen den Buchdeckeln vereint.« Peter Mohr / Literaturkritik.de»Gert Loschütz hat erneut einen sprachlich und inhaltlich intensiven Roman vor dem Hintergrund deutscher Geschichte geschrieben.« Hauke Harder / Leseschatz»Kein deutschsprachiger Autor beherrscht den modianohaft melancholischen Ton des Vergangenheitsinspekteurs so gut wie der 1946 in Genthin geborene Schriftsteller.« Katharina Teutsch / Frankfurter Allgemeine Zeitung»Gert Loschütz schreibt eine unaufdringliche, mitunter poetische, (...) bisweilen an Uwe Johnson erinnernde Prosa.« Gerrit Bartels / Der Tagesspiegel»Wir schlucken einmal schwer, geben die skeptische Reserviertheit auf und lassen uns verführen vom Versuch, die Welt zugleich aus den Akten und aus dem Zufall zu bauen.« Hubert Winkels / Süddeutsche Zeitung»Loschütz rekonstruiert mit erstaunlichem eisenbahntechnischem und meteorologischem Fachwissen und genauer Ortskenntnis den Hergang des Unglücks und die polizeilichen Ermittlungen zur Schuldfrage.« Peter Schultze-Kraft / Badische Zeitung»Seine akribische Nacherzählung des Eisenbahnunglücks macht jedem Krimi Konkurrenz, genauso die Geschichte von Carla, die sich immer wieder neu dreht und wendet.« Kais Harrabi / MDR Kultur»Seit 2005, seit Dunkle Gesellschaft, hat Loschütz ein herausragendes Buch nach dem anderen geschrieben. Besichtigung eines Unglücks fügt sich nahtlos in diese Reihe ein.« Christoph Schröder / Deutschlandfunk »Büchermarkt«»Er erzählt diesen Roman wirklich leise mit viel Sinn für Zwischentöne. (...) Ein Buch, das wirklich nachhallt.« Nadine Kreuzahler / rbb inforadio »Starke Sätze«»Es gab dieses reale Unglück und wie er das darstellt, die verschiedenen Personen und ihre Lebenssituationen, (...) das macht großes Vergnügen und es ist spannend.« Manuela Reichart / rbbkultur»Schicksal, Schuld, Liebe und Lebenslügen - das sind die Themen dieses meisterlich erzählten Romans.« Dorothea Westphal / Deutschlandfunk Kultur Buchkritik»Zeitgeschichtlich interessant und empfehlenswert.« Regine Mitternacht / Besprechungsdienst für öffentliche Bibliotheken»Loschütz gelingt in 'Besichtigung eines Unglücks' ein authentisches Bild Deutschlands in den ersten Kriegsmonaten, jene Zeit, die in der Regel nicht an erster Stelle der historischen Berichterstattung steht[...].« Stefan Alkofer / Modelleisenbahner
Schließen
Gebundenes Buch
Im Dezember 1939 prallen im sachsen-anhaltinischen Genthin zwei Züge aufeinander. Bis heute ist es das schwerste Zugunglück der deutschen Geschichte. Der in Genthin geborene Gert Loschütz widmet ihm seinen neuen Roman "Besichtigung eines Unglücks". Es ist ein in jeder …
Mehr
Im Dezember 1939 prallen im sachsen-anhaltinischen Genthin zwei Züge aufeinander. Bis heute ist es das schwerste Zugunglück der deutschen Geschichte. Der in Genthin geborene Gert Loschütz widmet ihm seinen neuen Roman "Besichtigung eines Unglücks". Es ist ein in jeder Hinsicht bemerkenswerter Roman geworden.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass dies der erste Roman des Autors ist, den ich gelesen habe. Völlig unverständlich, denn Gert Loschütz präsentiert sich in "Besichtigung eines Unglücks" als herausragender Erzähler mit feinem Gespür für zwischenmenschliche Töne und einer äußerst gelungenen Komposition des Textes.
Der erste Abschnitt widmet sich in szenischer Darstellung dem Zugunglück fast protokollarisch. Journalist Thomas Vandersee, Erzähler und Protagonist des Romans, erfährt fast beiläufig nach Jahrzehnten über das Unglück in seinem Heimatstädtchen und recherchiert erst stärker darüber, als er eine mögliche Verbindung zur Geschichte seiner Mutter Lisa darin erkennt. Diese protokollarische Rekonstruktion vermittelt eine regelrechte Sogwirkung. Wo die Befürchtung groß sein könnte, dass sich ein Autor in seinen Details verliert, ist diese bei Gert Loschütz völlig unbegründet. Durch die Unmittelbarkeit der Geschehnisse fühlte ich mich zeitweise wie in einem Film. Loschütz streift hier zudem das Genre eines Kriminalromans, vermittelt durch seinen Schreibstil aber zusätzlich eine große Melancholie, die dem Genre oft fehlt.
In den folgenden Abschnitten widmet sich Erzähler Vandersee den einzelnen Figuren und Schicksalen, die unmittelbar mit dem Unglück zusammenhängen - und findet sich urplötzlich in seiner eigenen Familiengeschichte wieder. Insbesondere die schwer verletzte Carla Finck bleibt für Thomas ein Mysterium, das auf ihn eine seltsame Faszination auslöst. Warum saß Carla mit einem anderen Mann als ihrem Verlobten Richard im Zug und gab sich später gar als die Ehefrau des Verstorbenen aus?
All dies präsentiert Loschütz mit viel Gefühl und Empathie, ohne auch nur annähernd kitschig zu werden. Durchgehend strahlt der Roman eine Ernsthaftigkeit und Eleganz aus, die in einer wirklich hinreißenden Auflösung münden. Ohne etwas über das Finale verraten zu wollen, kenne ich wohl kaum ein berührenderes und traurigeres in der jüngeren deutschsprachigen Literatur.
So ist "Besichtigung eines Unglücks" für mich einer der stärksten Romane des Jahres geworden, der sowohl inhaltlich als auch formal überzeugt und mich in beiden Punkten immer wieder überraschen konnte. Ich kann mich nicht daran erinnern, schon einmal Ähnliches gelesen zu haben. Nachholen muss ich jetzt nur noch, weitere Romane von Gert Loschütz zu lesen, auf die ich mich jetzt schon freue.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Kurz vor Weihnachten 1939 kommt es vor dem Bahnhof Genthin zum schwersten Zugunglück der deutschen Geschichte. Ein D-Zug rast mit voller Geschwindigkeit auf einen anderen, stehenden D-Zug – offiziell gibt es mindestens 196 Tote.
70 Jahre später recherchiert der Journalist Vandersee, …
Mehr
Kurz vor Weihnachten 1939 kommt es vor dem Bahnhof Genthin zum schwersten Zugunglück der deutschen Geschichte. Ein D-Zug rast mit voller Geschwindigkeit auf einen anderen, stehenden D-Zug – offiziell gibt es mindestens 196 Tote.
70 Jahre später recherchiert der Journalist Vandersee, der nach diesem Unglück in Genthin geboren wurde, zu diesem Geschehnis und ihm wird klar, dass seine Mutter Lisa, damals ein junges Mädchen, die Folgen miterlebt haben musste. Bei der Durchsicht der Unterlagen fällt ihm der mysteriöse Fall Carla Finck auf, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde und sich im Krankenhaus Carla Buonomo nannte. Ihr Begleiter, der im Zug starb, hieß Giuseppe Buonomo und war Neapolitaner, beide waren auf dem Weg von Berlin nach Düsseldorf. In welchem Verhältnis die Beiden zueinander standen, ist noch immer unklar und so forscht Vandersee weiter, was es mit der falschen Namensnennung von Carla Finck auf sich hat. Er findet heraus, dass sie Halbjüdin war und mit Richard Kuiper verlobt, einem Juden aus Neuss. Was machte sie dann mit Buonomo in Berlin?
Obwohl der Titel suggeriert, dass es hier vorrangig um das Eisenbahnunglück geht, nehmen die Geschichten um Carla Finck und Lisa, der Mutter Vandersees, annähernd den gleichen Raum ein. Wie der Autor selbst nimmt sein Alter Ego die wirklichen Vorgaben (den Aufeinanderprall, die Existenz Carla Fincks, ihres Verlobten und Giuseppe Buonomos sowie die Vorkommnisse im Krankenhaus) neben den für uns fiktiven, aber für ihn realen Personen als Grundlage, die damaligen Geschehnisse zu rekonstruieren. So entsteht eine minutiöse Beschreibung, wie es zu dem Aufprall kam, während Carlas und Lisas Leben meist in Umrissen dargestellt werden. Kein Wunder wenn man bedenkt, dass die Faktenlage hier eher dürftig ist. Doch auf beeindruckende Weise ergänzt er die ihm vorliegenden ‚Tatsachen‘ mit Möglichkeiten, die so wahrscheinlich wirken, dass sie sich wie selbstverständlich als das wirklich Geschehene lesen.
Ausgangspunkt des Ganzen ist das Unglück, von dem ausgehend ein Teil von Carlas Leben erzählt wird und daran anschließend Lisas, die, nicht ganz unwahrscheinlich, Carla begegnete. An weiteren losen Fäden, die an diesen und Vandersees eigener Geschichte hängen, gibt es zudem eine Reihe zusätzlicher Episoden: Hedwig Vorbeck, die die Toten und Verletzten zur Klinik brachte, wo sie ihr Mann als Arzt versorgte; Stolzenburgs Geschichte, der Ex-Mann von Lisas Tante sowie Der Eisfleck und viele mehr. Auch wenn Gert Loschütz diese ganzen Begebenheiten kunstvoll miteinbindet, finde ich den dazu genötigten Zufall doch etwas bemüht, der alles miteinander verbindende rote Faden ist gegen Ende kaum noch sichtbar.
Hervorzuheben ist die Sprache des Autors, die zwar eher sachlich-kühl, fast schon wie in einer Dokumentation wirkt, aber ungemein detailliert und bildhaft ist, sodass man dem Geschehenen und den Figuren trotzdem nahe kommt.
"Kein Winter wie aus dem Reiseprospekt, sondern ein dunkler, bedrückender, nach hinten verlegter Totensonntag."
Eine ungewöhnliche Lektüre, bei der Wahrheit und Fiktion nicht zu unterscheiden sind.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Annäherung an einen Vorfall
Gert Loschütz ist ein sorgfältiger Autor, der sich behutsam seinem Thema und der Zeit annähert. Dadurch wird er sehr glaubwürdig. Schon das dunkle Cover deutet an, das es um Einen düsteren Vorfall in einer schlimmen Zeit geht, ein …
Mehr
Annäherung an einen Vorfall
Gert Loschütz ist ein sorgfältiger Autor, der sich behutsam seinem Thema und der Zeit annähert. Dadurch wird er sehr glaubwürdig. Schon das dunkle Cover deutet an, das es um Einen düsteren Vorfall in einer schlimmen Zeit geht, ein Zugunfall mit vielen Tote und Verletzten.
Es wird der Unfallursache nachgespürt, auch, wie mit den Opfern umgegangen wurde sowie die jahrelangen Folgen.
Gert Loschütz überzeugt mit einer Romanstruktur in 5 Teilen und einem genauen Stil, der das Buch auch sprachlich auszeichnet.
Interessant auch die Rechercheleistung des heutigen Protagonisten, der zwar viel mit dem Autor gemein hat, aber nicht eins zu eins derselbe ist.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Fünf Richards
Dem neuen Roman von Gert Loschütz mit dem distanziert wirkenden Titel «Besichtigung eines Unglücks» liegt thematisch das schwere Eisenbahn-Unglück im Bahnhof von Genthin am 22. Dezember 1939 zugrunde. Eine Vorstufe zu dem Buch war das vor zwanzig …
Mehr
Fünf Richards
Dem neuen Roman von Gert Loschütz mit dem distanziert wirkenden Titel «Besichtigung eines Unglücks» liegt thematisch das schwere Eisenbahn-Unglück im Bahnhof von Genthin am 22. Dezember 1939 zugrunde. Eine Vorstufe zu dem Buch war das vor zwanzig Jahren zu dieser Katastrophe produzierte Hörspiel des Autors. Als dort Geborener erzählt er neben den sorgsam recherchierten Umständen, die zu dem Unglück führten, nicht nur die fiktive Geschichte eines weiblichen Unfallopfers, er unterlegt seinem Ich-Erzähler auch etliche autobiografische Details.
Im ersten der fünf Kapitel wird unter der Überschrift «Vier Sekunden» vom bis heute schwersten Eisenbahn-Unglück auf deutschem Boden berichtet. Dabei ergibt sich tatsächlich aus einer Reihe der verschiedensten, unglücklich zusammen treffenden Faktoren, dass letztendlich ein vier Sekunden zu früh gegebenes, manuelles Not-Haltesignal aus dem Stellwerk zum verhängnisvollen Stopp eines vollbesetzten D-Zug führte, auf den dann ein ebenso vollbesetzter, nachfolgender D-Zug ungebremst mit über 100 km/h auffuhr. Der sich aus den Gerichtsunterlagen und den Akten der Reichsbahn ergebende und für den Roman aufbereitete Ablauf des Geschehens ist spannend wie ein Krimi, auch was die archaisch anmutende Signaltechnik anbelangt. Aber Vorsicht! Wer da glaubt, das alles wäre heute mit modernster Elektronik nicht mehr möglich, der sei an die beiden Regionalzüge erinnert, die am 9. Februar 2016 nahe Kolbermoor frontal aufeinanderprallten. Schuld war modernste Technik, das Smartphone nämlich, von dem der Fahrdienstleiter abgelenkt war, als er manuell beide Züge in die einspurige Strecke einfahren ließ (aber das nur nebenbei!).
Im zweiten Kapitel wird von Carla berichtet, einem der Unfallopfer, die schwerverletzt überlebt. Sie ist mit dem Juden Richard Kuiper verlobt, der von den Nazis gesucht wird. Vor der verhängnisvollen Zugfahrt lernt sie einen Italiener kennen, mit dem sie zwei Tage später nach Berlin fährt, er überlebt das Unglück nicht. Im Krankenhaus gibt sie sich dann als seine Frau aus, ohne dass erkennbar wird, warum. Es darf spekuliert werden! Sie ist‹Halbjüdin›, nach der Ehe wäre sie ‹Volljüdin› mit allen negativen Konsequenzen, das ruft dann sogar die Gestapo auf den Plan. Mit dem Ladenmädchen Lisa kommt schließlich die Mutter des Journalisten und Ich-Erzählers Thomas Vandersee ins Spiel, sie versorgt Carla vor der Entlassung mit neuer Kleidung. Als junge Frau lernt Lisa mit dem namenlos bleibenden «Begabten» einen Violin-Virtuosen kennen und lieben, der sie unterrichtet. Er nimmt sie dann aber doch nicht mit in die USA, als er von dort ein lukratives Angebot bekommt. Denn er hat leider noch eine andere Geliebte, eine Ménage-à-trois aber kommt für Lisa nicht in Frage.
Als Journalist, lässt uns der Ich-Erzähler wissen, wurde er nach einem Vortrag von einem hochbetagten Zuhörer angesprochen und auf das Zugunglück in seiner Heimatstadt hingewiesen. Zunächst widerstrebend, dann aber immer eifriger habe er zu recherchieren begonnen und sich diverse Notizen gemacht, aus denen dann im vierten Kapitel zitiert wird. Eine journalistisch anmutende, eher unsichere Erzählhaltung ist das typische Merkmal dieser Spurensuche. Es bleibt reichlich Raum für Spekulationen, die Hauptrolle spielt bei alledem immer der Zufall. Kein Zufall aber ist es, wie sich erst ganz am Schluss herausstellt, dass die fünfmal verheiratete Carla immer Ehemänner mit Namen Richard hatte: Ryszard Wósz, Ricardo Fuchs, Richard Lessnik, Richard White, Richard Oettinger. Ein beredtes und auch betroffen machendes Zeichen lebenslanger Reue, Zeugnis ewiger Verbundenheit zudem mit ihrem einstigen Verlobten, den sie so schmählich seinem Schicksal überlassen hat. Dieser aus einer Verzahnung von Fakten und Fiktion entwickelte Roman wird reportageartig erzählt, mit einer elegischen Grundierung natürlich. Ein wenig leidet er jedoch an seinen disparaten Erzählebenen, es fehlt ihm ein stimmiger Erzählbogen als narrativer Überba
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Besichtigung von Lebenswegen
„Es ist die Liste, die am nächsten Tag in der Genthiner Zeitung abgedruckt wurde, die erste einer ganzen Reihe von Listen, die bereits den Namen enthielt, der mich lange beschäftigen würde, weil es der einzige ausländische war. Buonomo …
Mehr
Besichtigung von Lebenswegen
„Es ist die Liste, die am nächsten Tag in der Genthiner Zeitung abgedruckt wurde, die erste einer ganzen Reihe von Listen, die bereits den Namen enthielt, der mich lange beschäftigen würde, weil es der einzige ausländische war. Buonomo Giuseppe aus Neapel.“ (Zitat Pos. 600)
Inhalt
An diesem 22. Dezember 1939, um 0 Uhr 53, sind die Wetterverhältnisse extrem schlecht und knapp vor dem Bahnhof Genthin prallen zwei Züge aufeinander. Vier entscheidende Sekunden führen zu einem Trümmerfeld mit hunderten Toten und Verletzten und dennoch ist dieses schwere Zugunglück durch die deutsche Geschichte der darauffolgenden Jahre in Vergessenheit geraten. Der Journalist Thomas Vandersee hat seine Kindheit in Genthin verbracht. Als er von einem alten Herrn, der Lisa, die Mutter von Thomas, aus Schultagen vom Sehen kannte, einen Zeitungsartikel über dieses Zugunglück erhält, ist er zunächst nicht interessiert. Doch eine Bemerkung über eine der beiden Unglückslokomotiven, die unter einer geänderten Nummer wieder in Betrieb genommen wurde, ändert alles. Er beginnt zu recherchieren, doch während er versucht, anhand der Akten den Unglückshergang zu rekonstruieren, tauchen eine Reihe weiterer Fragen auf. Carla Finck war in diesem Zug, warum steht ihr Name auf keiner Opferliste? Immer tiefer taucht er in Einzelschicksale ein und gleichzeitig auch in die Vergangenheit der eigenen Familie, in die Geschichte seiner Mutter.
Thema und Genre
Was als Recherche zu einem tragischen Eisenbahnunglück beginnt, erweitert sich in diesem Roman rasch zu den Geschichten von irgendwie mit diesem Zugunglück in Verbindung stehenden Menschen mit ihren Beziehungen, Träumen, Geheimnissen. Es geht um Entscheidungen, Zufälle und den Faktor Zeit, denn es sind immer wenige Sekunden, die alles verändern.
Charaktere
Der Autor nimmt sich Zeit für seine Figuren, er schildert ihr Verhalten und Entscheidungen im Kontext mit der damaligen Zeit. Thomas Vandersee erkennt, dass es die Familiengeheimnisse seiner Kindheit und Jugend sind, die ihn prägen.
Handlung und Schreibstil
Der Roman umfasst fünf große Teile und Thomas Vandersee als Ich-Erzähler ergänzt die Geschichte noch mit seinen persönlichen Erinnerungen. Der erste Teil führt uns in die Gegenwart, in das Leben und den Alltag des Journalisten Thomas Vandersee als Ich-Erzähler, unterbrochen von minutiösen Schilderungen möglicher Hergänge des Zugunglücks, wie auch die Akten unterschiedliche Versionen zur Klärung der Schuldfrage darstellen. Im zweiten Teil geht es um das Leben von Carla Finck, im personalen Mittelpunkt des dritten Teils steht Lisa, die Mutter von Thomas, der vierte Teil trägt den Titel „Aus den Notizheften“, denn Thomas macht sich zu allen Alltagsereignissen Gedanken und füllt damit Notizhefte, die er alle aufbewahrt, weil sie seine Vergangenheit dokumentieren. Der letzte, fünfte Teil bringt nochmals ergänzende Details zu Carlas Leben, einige Fragen werden gelöst, andere bleiben offen und überlassen es uns, darüber nachzudenken. Die poetische, klare Sprache schildert und beschreibt eindrücklich.
Fazit
Dieser facettenreiche Roman ist nicht nur die Besichtigung eines Unglücks, sondern vielmehr eine vielschichtige, intensive Besichtigung von Lebenswegen und folgenreichen Entscheidungen, von Sekunden, die das Leben eines Menschen verändern können.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Spannender Anfang
Der deutsche Buchpreis bot letztes Jahr nicht viel. Dieser hätte 5 Sterne verdient, wenn denn das Ende so wäre wie der Anfang.
Unglaublich spannend berichtet Loschütz über das größte Zugunglück der deutschen Eisenbahn 1939 in Genthin. Er …
Mehr
Spannender Anfang
Der deutsche Buchpreis bot letztes Jahr nicht viel. Dieser hätte 5 Sterne verdient, wenn denn das Ende so wäre wie der Anfang.
Unglaublich spannend berichtet Loschütz über das größte Zugunglück der deutschen Eisenbahn 1939 in Genthin. Er geht selbst den Irrwegen nach, etwa das eine Inversionswetterlage die Sicht behindert hätte. Stattdessen wir deutlich, dass der zweite Lokführer nur wegen der im Krieg befindlichen Kollegen einen Personenzug führen durfte und mehrfach Haltesignale überfuhr. Zuletzt wurde der erste Zug in Genthin angehalten, weil das Signal 4 Sekunden zu früh auf Halt geschaltet wurde.
Auch das zweite Kapitel gefällt mir. Hier wird vor allem das Leben von Clara Finck geschildert, die mit einem Juden in Düsseldorf liiert, im Zug mit einem Italiener reist und sich später als dessen Witwe ausgibt.
Dann aber wechselt der Roman zur Mutter unseres Ich-Erzählers, die aber mit dem Unfall nur insofern zu tun hatte, als dass sie die Briefe Claras gekannt und für die Korrespondenz gesorgt hatte.
Auch wenn das kurze letzte Kapitel alles wieder zusammenführt, ist mir dieser Strang zu dünn und die Familiengeschichte nicht interessant genug. Also 4 Sterne.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Autor Gert Loschütz nimmt ein Zugunglück vergangener Zeiten - nämlich im Dezember 1939 - zum Ausgangspunkt seines Romans. Wobei es auf eine wenig dominante Art auch im Mittelpunkt steht. Wenige Tage vor Weihnachten hat es sich ereignet, in einer Zeit, in der der Zweite Weltkrieg noch …
Mehr
Autor Gert Loschütz nimmt ein Zugunglück vergangener Zeiten - nämlich im Dezember 1939 - zum Ausgangspunkt seines Romans. Wobei es auf eine wenig dominante Art auch im Mittelpunkt steht. Wenige Tage vor Weihnachten hat es sich ereignet, in einer Zeit, in der der Zweite Weltkrieg noch jung und frisch war, als man noch nicht wusste, was für tragische Wendungen er nehmen und wie lange er dauern würde.
Es ist eine wahre Begebenheit, dieses Unglück von Genthin nahe Magdeburg und soll das größte bisherige in Deutschland sein. Mit einer Unmenge von Todesopfern.
Loschütz fokussiert sich auf eine junge Frau, Carla, mit einem Juden in Düsseldorf verlobt, aber mit einem italienischen Herren aus Berlin kommend, wo sie mehrere Wochen lang ein Zimmer geteilt haben. Wir erfahren eine Menge über dieses "Dreieck".
Schlauer wird man dadurch nicht unbedingt, bin ich jedenfalls nicht geworden. Erzähler ist der Journalist Thomas Vandersee, dessen Mutter Lisa aus Genthin stammt und damals im weitesten Sinne auch mit dem Unglück zu tun hatte. Er ist derjenige, der über die Zusammenhänge recherchiert, weit über das Unglück hinaus. Genauer gesagt bis in das Leben des Journalisten selbst hinein, also bis in die Gegenwart.
Und genau dieser Umstand ist es, der mich so sehr verwirrt hat. Dadurch ging für mich jegliche Zentrierung flöten. Ich hatte so schon Mühe, am Ball zu bleiben, von Beginn an: denn das Unglück selbst bringt eine ganze Fülle von Personal auf die Bühne, sie wuseln herum wie Ameisen. Mich zumindest haben sie verwirrt. Und aus diesen Irrungen und Wirrungen bin ich bis zum Ende des Romans nicht hinausgekommen.
"Besichtigung eines Unglücks" ist ein Roman, der polarisiert. Einer, der wahrscheinlich mehr Fürsprecher hat als Kritiker, was ich ihm von ganzem Herzen gönne. Leider war es jedoch nicht ganz mein Fall!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Zwei Tage vor Heiligabend 1939 kommt es in Genthin zu einem furchtbaren Zugunglück in Folge dessen über 180 Personen starben. Im Zug die (Halb)jüdin Carla Finck, jedoch nicht in Begleitung ihres Verlobten Richard, sondern des Italieners Guiseppe Buonomo. Während dieser stirbt, …
Mehr
Zwei Tage vor Heiligabend 1939 kommt es in Genthin zu einem furchtbaren Zugunglück in Folge dessen über 180 Personen starben. Im Zug die (Halb)jüdin Carla Finck, jedoch nicht in Begleitung ihres Verlobten Richard, sondern des Italieners Guiseppe Buonomo. Während dieser stirbt, gibt Carla sich als seine Frau aus - warum?
Der Ich-Erzähler Thomas Vandersee, eine ähnliche Konstellation lebend, versucht die Geschehnisse (ohne eindeutiges Ergebnis) zu ergründen und gelangt dabei zu der Frage, ob seine Mutter Lisa Carla gekannt haben könnte...
Die Vorstellung versprach ein sehr interessantes Buch, jedoch ist die Umsetzung meiner Meinung nach nicht komplett gelungen. Wie schon oft bei für den Buchpreis nominierten Büchern war ich letztendlich doch enttäuscht und ich weiss nicht ob dies evtl.nur an meiner erhöhten Erwartung lag.
Der Schreibstil ist - abwechselnd ausformuliert oder in einer Art Stichpunkten - gewöhnungsbedürftig, doch dies ist nicht der Grund dafür. Vielmehr blieb ich am Ende etwas ratlos zurück, da zuviel nur angedeutet und der Interpretation des Lesers überlassen wurde.
Informativ bezüglich des beschriebenen Unglückes ist das Buch, jedoch würde ich es nicht noch einmal lesen bzw. hinterlässt es bei mir keinen bleibenden Eindruck.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Gert Loschütz, der Autor dieses Romans, hat es sich nicht einfach gemacht und einen an Spannung und Wendungen nach allen Seiten kaum zu überbietenden Roman vorgelegt.
Es gibt einen Erzähler, Thomas, der sich durch Berge von alten Akten, Briefen und Berichten arbeitet, um ein …
Mehr
Gert Loschütz, der Autor dieses Romans, hat es sich nicht einfach gemacht und einen an Spannung und Wendungen nach allen Seiten kaum zu überbietenden Roman vorgelegt.
Es gibt einen Erzähler, Thomas, der sich durch Berge von alten Akten, Briefen und Berichten arbeitet, um ein grauenhaftes Zugunglück zu rekonstruieren.
Bei seinen Recherchen trifft er auf persönliche Schicksale der Verunglückten und verknüpft sie gleichzeitig mit Privatem.
Besonders berührend stellt sich das Schicksal der in einem der Züge verunglückten Carla Fink dar, die sich nach dem Unglück einen anderen Namen gegeben hatte. Es verwundert allerdings nicht, denn Carla war Halbjüdin und mit einem Volljuden, Richard Kuiper verlobt, den sie anscheinend schützen wollte.
Der Erzähler, Thomas, hat herausgefunden, daß es eine Verbindung zwischen Carla und Thomas´ Mutter gegeben haben könnte, denn diese war zum Zeitpunkt des Unglücks in einem Geschäft tätig, das Carla persönliche Dinge ins Krankenhaus geliefert hat, die Botin war offensichtlich Lisa, Thomas´ Mutter.
Alles in allem ein sehr herausfordernder Roman, den man nicht einfach so nebenbei lesen sollte, denn da gibt es viele tiefgreifende Dinge, die einem sonst entgehen könnten.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Hochinteressant
Das Zugunglück war mir nicht bekannt und ich fand die Beschreibungen der damaligen Abläufe im Zugverkehr hochinteressant. Man kann sich heute kam vorstellen, wie „hemdsärmlig“ vor weniger als 100 Jahren gearbeitet werden musste. Ich war anfangs etwas …
Mehr
Hochinteressant
Das Zugunglück war mir nicht bekannt und ich fand die Beschreibungen der damaligen Abläufe im Zugverkehr hochinteressant. Man kann sich heute kam vorstellen, wie „hemdsärmlig“ vor weniger als 100 Jahren gearbeitet werden musste. Ich war anfangs etwas irritiert, weil ich von einem Zusammenstoß ausging, es war aber ein Auffahrunfall. Deshalb habe ich manches Detail zu Beginn nicht einordnen können. Das Buch umfasst 5 Kapitel und das 1. befasst sich mit dem Zugunglück und ist sehr gut geschrieben. Das 2. Kapitel beschreibt die Lebensumstände von Carla, die im Zug saß, verletzt überlebte und einen falschen Nachnamen angab. Über die Menschen, die durch ein solches Unglück zufällig zu einer Schicksalsgemeinschaft werden, erfährt man in der Regel nichts. Da es jeden treffen könnte, finde ich die Geschichten dahinter sehr erzählenswert und dementsprechend hat mir auch dieser Bereich gut gefallen. Kapitel 3 und 4 wirken ein bisschen verloren und hätte es für meinen Geschmack nicht gebraucht. Stattdessen lieber noch mehr Geschichten über die Menschen hinter dem Unglück, analog zu Carla. In Kapitel 5 wird dann Carlas späterer Lebensweg aufgegriffen und das war ein guter Abschluss. Insgesamt eine sehr interessante Lektüre mit einigen Längen in Kapitel 3 und 4.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für