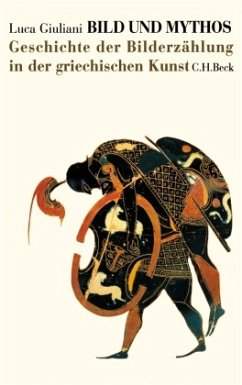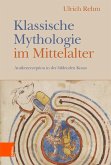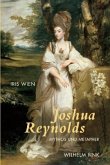Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Das Einbrechen des Erzählens in die Beschreibung der Welt: Luca Giulianis feine Beobachtungen an der griechischen Vasenmalerei
Diese große Veröffentlichung des Münchner Archäologen Luca Giuliani zur griechischen Vasenmalerei wird ein Grundlagenwerk werden, wie es seine Monographie über die Bildniskunst der römischen Republik geworden ist. Es ist ein Dokument der Nüchternheit in einer Zeit, in der keine Ringvorlesung und keine Podiumstagung auf Diskursschwaden zum Bild verzichtet. Dennoch oder gerade deshalb liest auch der Nicht-Archäologe Giulianis Bildinterpretationen mit detektivischer Spannung, vielleicht gerade weil sie so methodisch streng und kompromißlos durchgeführt werden.
Anders als der Leser vielleicht annimmt, ist der heutige Seh-Analphabetismus viel größer als die Unkenntnis der griechischen Mythen. Daß der Teilnehmer an Giulianis Sehschule sein blaues, oder besser gesagt, sein schwarzrotes oder rotschwarzes Wunder erleben wird, ist allerdings nicht nur dessen archäologischer Kompetenz zu verdanken, sondern vor allem auch - fast möchte man sagen: seinem Amateur-Status, wenn das Wort bei einem in der Wolle gefärbten Fachmann nicht so mißverständlich wäre. Dieser "Amateur" betrachtet die Kunst genau, aber nie mit "interesselosem Wohlgefallen", sondern als interessierter Liebhaber und führt uns als dieser durch den Irrgarten ikonographischer Bilderrätsel. "Liebe" ist in der Fachwelt seltsamerweise so wenig selbstverständlich wie seine elegante Schreibweise.
Giuliani wurde durch Lessings Laokoon-Aufsatz vom Erkenntniszauber wie von einem coup de foudre angerührt und machte sich dessen Unterscheidung zwischen Malerei und Poesie zu eigen: Körper sind nebeneinander im Raum anzutreffen, deshalb sind Bilder die unter dem Vorrang des Raums hergestellte Kunstform. Handlungen, die ein Nacheinander in der Zeit darstellen, das ist der Stoff von Erzählungen. Erzählen ist eine unter der Kategorie der Zeit verlaufende Kunstform.
Giuliani untersucht nun die antiken Vasenbilder des siebten, sechsten und fünften Jahrhunderts, und zwar unter dem Gesichtspunkt, wie im siebten Jahrhundert das Narrative in die bis dahin "deskriptiven" Bilder der geometrischen Kunst einbricht. Bilder erzählten vorher keine Geschichte, sondern stellten den Schiffbruch, den Aufbruch, den Tod des "aristokratischen Herrn Jedermann" dar, bis hin zur Verabschiedung der Spannung zwischen dem Narrativen und dem Deskriptiven in der "Illustration" im zweiten Jahrhundert. Die unterschiedlichen Modi des Beschreibens und des Erzählens schließen sich nach Giuliani natürlich keineswegs aus, es handelt sich um "komplementäre Möglichkeiten". Die Reibung zwischen Bildermacht und Erzählmacht ist in dem Augenblick verschwunden, wo das Bild zur bloßen Illustration des Erzählten herabsinkt. Die griechische Kunst wird hingegen, solange sie "stark" ist, zum Austragungsort der Spannung zwischen Bild und Text.
So entsteht ein suggestives Bild der Verarbeitung einer spezifischen Kunst in einer anderen Kunst. Dadurch kann die Ikonographie - exemplarisch und durchweg glänzend dargestellt anhand der Blendung des Polyphem, der Gesandtschaft an Achill, der Kirkeepisode, des Mordes am alten König Priamos, der Orest-Entsühnung - ohne Andeutungsgeraune, ohne mystische Fernverweise kristallklar und erschöpfend verhandelt werden.
Den Einbruch des Narrativen haben wir, wenn nicht nur ein Pferd abgebildet ist, sondern ein Pferd mit Rädern. Es könnte immer noch ein Kultpferd sein, aber dann wäre es wohl mit einer Bodenplatte dargestellt und nicht mit Rädern an allen vier Beinen. Außerdem sehen wir Krieger aus Luken herausschauen. Und das ist nun wirklich eine tolle Geschichte, denn damit sehen wir etwas, das logischerweise unsichtbar sein muß, wenn die List klappen soll. Wir wissen damit mehr als derjenige, der nur das Pferd auf Rädern sieht. Das Unheimliche der Szene ist, daß wir durch so viele Fenster in ein Pferd hineingucken, aus dem so viele herausgucken, die "in Wirklichkeit", im epischen Text, nicht herausgucken konnten. Der Maler spielt mit Sichtbarem und Unsichtbarem und wir müssen da mitspielen. Schockartig berührt den Betrachter an einem solchen Bild nicht, daß wir es identifizieren können, sondern daß es die Konsequenzen dieser Erzählung, den Status der Zerrissenheit für jede einzelne Figur darstellt. Paradoxerweise wird gerade durch die Fenster die Klaustrophobie ausgedrückt. Die Krieger sind zwischen einem Drinnen und einem Draußen, sie denken an nichts anderes als an die bedrohliche, nahe Zukunft.
Man kann nicht genug bewundern, wie gut Giuliani sieht, wie scharfsinnig er die einzelnen Bildlösungen Schritt für Schritt vorführt. Das läßt sich an dieser Stelle leider nicht zeigen. Nur soviel zu einer Figur mit besonderem "Mehrwert": Der zürnende Achill soll von einer Gesandtschaft zur Wiederaufnahme des Kampfs bewogen werden. Ihn zornig zu zeigen wäre unsinnig, da er die Gesandten freundlich empfängt. Also müssen Bildchiffren gefunden werden, die das erzählerische Nacheinander - andauernder Zorn, unterbrochen von vorübergehender Freundlichkeit - auch im Gleichzeitigen einfangen können. Hier spielt zum erstenmal etwas eine Rolle, was dann in unserer Romantik wieder so eine große Rolle spielen wird: daß das Bild zur Identifikation mit Figuren auffordert, die dort nicht agieren, sondern der Szene als Zeugen beiwohnen, aus dem Bild heraussehen und den Betrachter zwingen, mit seinen Augen zu sehen. Man denke an die Figuren Caspar David Friedrichs. So wird die Amphora oder Schale zum Träger der Erschütterung ihres Betrachters gemacht, der mit einer Stellvertreterfigur in das Gefäß einbezogen wird. So wird der schweigende Achill des Vasenbildes auch zu einer Darstellung von dem, was ein Bild vermag. Das Schweigen des Bildes - es gehört ja zu Giulianis Standardbehauptungen, daß die Bilder schweigen - wird in den schweigenden Achill überführt, in ihm symbolisiert.
Je größer die Möglichkeit des Vasenmalers ist, in den Mythos einzugreifen, desto stärker die Bilder, sagt Giuliani. Die Ermordung des Priamos kann auf verschiedene Weise dargestellt werden, ein Höhepunkt ist die Tötung des Großvaters durch seinen kleinen Enkel, den der Mörder als Keule benutzt. Diese Art von Furcht und Schrecken hat die Ilias nicht verbreitet. Das bedeutet eine Steigerung der Wirkungsmacht der Vasenmalerei, nicht eine Umdichtung des Mythos. Aber qualitativ ist das insofern etwas Neues, als man wirklich den Eindruck hat, es solle nicht als Realschilderung, sondern als Schock, den das Geschilderte auf den Betrachter auslöst, neu sein.
Giuliani ist Rationalist. Wenn wir mit ihm auf großartige Weise sehen gelernt haben, dürfen auch die Einwände zur Sprache komme. Warum mußte er ausgerechnet für das eigentlich Bildhafte einen Begriff nehmen, der aus der Schriftmetaphorik stammt, nämlich die descriptio, die Beschreibung? Diese Wortwahl bereitet uns ein Unbehagen. "Beschreibungen" mußten wir in der Schule von Bildern machen, sie sind jedoch eigentlich nicht das, was Bilder selbst in erster Linie tun. Das macht die Wahl dieses blassen Begriffs "deskriptiv" so untriftig. Den Vorgang für das Bildspezifische zu erklären ist nur einleuchtend anhand der Lessingschen Vorgabe. Hier hätte Giuliani beherzt aus dem Schatten Lessings heraustreten sollen.
CAROLINE NEUBAUR
Luca Giuliani: "Bild und Mythos". Geschichte der Bilderzählung in der griechischen Kunst. C. H. Beck Verlag, München 2003. 367 S., 87 Abb., geb., 34,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH